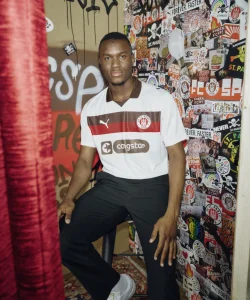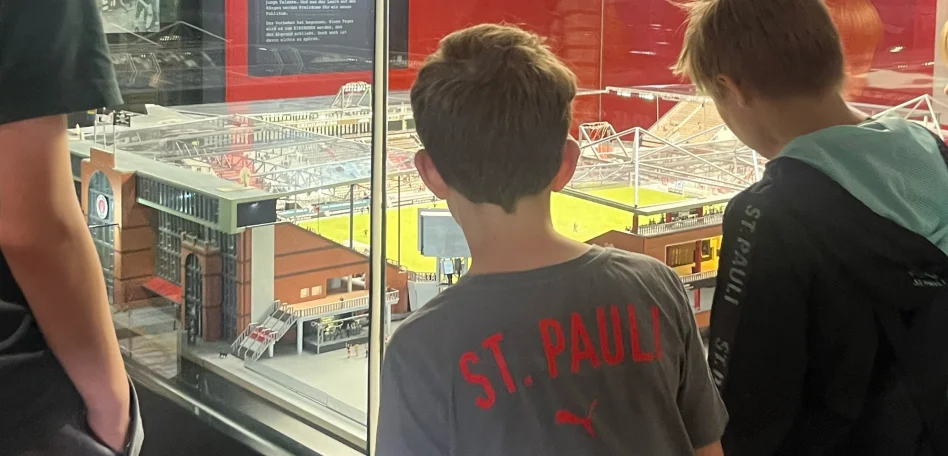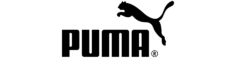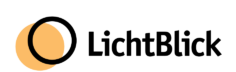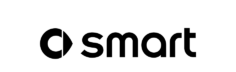Vereinshistorie
Hier findet Ihr einen detaillierten Überblick über die Geschichte des FC St. Pauli.

Von den Anfängen der Fußlümmelei und der Gründung des FC St. Pauli
Die Vorgeschichte des FC
"Die Geschichte des FC St. Pauli von 1910 beginnt nicht, wie der Name vermuten lässt, im Jahre 1910, sondern mindestens drei Jahre früher. Seine Ursprünge sind untrennbar verbunden mit der des Hamburg - St. Pauli Turnvereins von 1862, der übrigens heute noch existiert. Dort wurde bereits ab 1907 gegen den Ball getreten, allerdings noch nicht im Rahmen eines geregelten Spielbetriebs. Erst 1910 traten die Kicker des Klubs dem Norddeutschen Fußball-Verband bei, 1911 bestritten sie die ersten Punktspiele, und 1924 trennten sie sich schließlich vom Turnverein und gründeten den FC St. Pauli", so recherchierte René Martens für sein 1997 erschienenes Buch "You’ll Never Walk Alone".
Die ersten Schritte in Braun-Weiß
An einem feuchtfröhlichen Abend fanden sich in der Kneipe August Tenne einige Fußball begeisterte Mitglieder der Spiel- und Sportabteilung, die 1899 von Franz Reese im Anschluss an das Turnfest auf dem Heiligengeistfeld gegründet worden war, zusammen und beschlossen, eine eigene Sparte für ihren Sport ins Leben zurufen.
1907 wurden dann die ersten Spiele gegen Teams des Schwimmvereins Aegir ausgetragen und auch die ersten finanziellen Probleme tauchten auf: "1908 stand zum Beispiel ein Minus von 79 Mark zu Buche", weiß Martens zu berichten.
1909 setzte Amandus Vierth die Farben der einheitlichen Spielkleidung durch, die bis heute Bestand haben: Braun und Weiß waren fortan auch die offiziellen Vereinsfarben. 1919 stieg der St. Pauli TV erstmals in die damalige höchste Spielklasse auf, doch auch gleich wieder ab. In den 20er Jahren erlebten die Kicker eine wahre Berg- und Talfahrt, oder wie Martens schreibt: "Die Jahre im Fahrstuhl".
Erst 1930 gelang der Aufstieg mit Spielern wie Giza, Klages, Wolf, Stamer, Salz, Wrede, Wulf, Kracht, Borgwardt und Schmidt.
1931 qualifizierte sich St. Pauli erstmals für die Spiele um die Norddeutsche Meisterschaft, doch scheiterte man im Achtelfinale an Phoenix Lübeck, ausgerechnet auf dem Platz des HSV am Rothenbaum. 1933 stiegen die braun-weißen Kicker erneut ab, denn man konnte sich nicht für die neu gegründete Gauliga Nordmark qualifizieren. 1936 der Wiederaufstieg in die erste Liga, mit dem Kriegsbeginn wieder einmal der Abstieg.
In den Kriegsjahren pendelte der FC St. Pauli ständig zwischen der Gauliga Nordmark und der Gauliga Hamburg.

St. Paulis Wunder-Elf 1947 v.l.: Trainer Sauerwein, Dzur, Miller, Köpping, Börner, Lehmann, Schaffer, Bielstein, Sump, Koch; vorn: Böhme, Hempel, Delewski, Appel, Stender. Foto aus "75 Jahre FC St. Pauli"
Der Krieg war vorbei, doch mit dem Wiederaufbau sollte es noch etwas dauern, - jedenfalls was die zerstörten Gebäude betraf. Karl Miller allerdings brachte den Wiederaufbau in Sachen Fußball wesentlich schneller voran.
Mit der fast schon legendären Schlachterei seiner Eltern in der unweit des Millerntors gelegenen Wexstraße und den dort bereitstehenden Fleischvorräten, lockte Miller nach dem Krieg zahlreiche Spitzenfußballer zum FC St. Pauli. Vornehmlich kamen Spieler wie u. a. Heinz Hempel, Heinz Köpping oder auch Walter Dzur die Elbe aus Dresden hinauf um fortan in Braun und Weiß zu kicken. Eine ganz kurze Zeit spielte sogar der spätere Nationaltrainer Helmut Schön für den FC.
Zunächst musste der Verein seine Heimspiele auf gegnerischen oder neutralen Plätzen austragen, denn das Stadion war komplett zerstört, überhaupt hatte der gesamte Stadtteil St. Pauli reichlich Schaden genommen. Im ersten Nachkriegsjahr errichteten Mitglieder des FC St. Pauli eine neue Spielstätte auf dem Heiligengeistfeld, direkt gegenüber der alten Feuerwache, welches am 17.November 1946 mit einem Spiel gegen den FC Schalke 04 eingeweiht wurde. Lange führte der FC in der damaligen Stadtliga und sah schon wie der sichere Meister aus, doch wurde man am letzten Spieltag doch noch vom Hamburger SV überholt.
Doch bereits in der folgenden Saison 1946/47 trumpften die Kiezkicker groß auf: „Man fühlte sich beinahe nach Brasilien versetzt, wenn die St. Pauli-Truppe Ball und Gegner laufen ließ“, heißt es im Jahrbuch zum 75. Vereinsjubiläum. Am Ende dieser Spielzeit stand man dann endlich vor den Rothosen und feierte die Stadtmeisterschaft.
In der ersten Oberligasaison 1947/48 verlor der FC nur drei Spiele in der Meisterschaftsserie und unterlag erst im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen den 1.FC Nürnberg. In der Folgesaison kam der FC „nur“ bis ins Viertelfinale. Bis zur Spielzeit 1953/54 musste man stets mit einem Platz hinter dem HSV vorlieb nehmen, dann aber wurde Hannover 96 Meister der Oberliga-Nord, der FC belegte den zweiten Rang, der HSV rangierte erst auf dem 11.Platz. In den folgenden Jahren stritten St. Pauli und Altona 93 meist um die Plätze hinter den Rothosen.
Zwischen 1955 und 1958 stemmten sich die Kicker vom Millerntor in jeder der drei Spielzeiten ständig gegen einen drohenden Abstieg. Viele Kicker der Wunder-Elf wechselten zu anderen Vereinen oder hängten die Fußballschuhe an den berühmten Nagel. Neue, junge Spieler waren gekommen und wurden nun vom ehemaligen FC-Spieler Heinz Hempel trainiert und mussten sich mit Platzierungen zwischen dem 9. und 13. Tabellenrang zufrieden geben.
Nach nur 14 Jahren musste das 1946 errichtete Stadion der Internationalen Gartenausstellung weichen und so wurde 1960 mit dem Bau des heutigen Stadions begonnen. Doch erst in der Rückrunde der Saison 1961/62 trug St. Pauli dort auch seine Heimspiele aus.
Fast elf Jahre war Hempel als Trainer am Millerntor tätig, bevor ihn Präsident Wilhelm Koch 1962 entließ. Seine Nachfolger Otto Westphal, Otto Coors und Kurt Krause blieben jeweils nur ein, bzw. zwei (Krause) Jahre am Millerntor, sodass Hempel im Herbst 1968 noch einmal das Zepter bis zum Saisonende übernahm. Als nach der Saison 1962/63 dann die Bundesliga eingeführt wurde, verweigerte der DFB dem FC St. Pauli die Teilnahme an der neuen höchsten deutschen Spielklasse und so starteten die Kiezkicker in der Regionalliga-Nord, wo sogleich die Meisterschaft eingefahren wurde.

Meistermannschaft 1964 v.l.: stehend: Trainer Westphal, Deininger, Hehl, Acolatse, Pokrop, Osterhoff, Danjus, Gieseler, Haecks, Stülcken, Torwart Thoms, Porges; sitzend: Kokoska, Bergmann, Stothfang, Bergeest, Eppel, Wunstorf, Lombard, Gehrke. Foto aus "75 Jahre FC St. Pauli"
In zehn Jahren nahm der FC St. Pauli sechs Mal an den Aufstiegsrunden zur neu geschaffenen Bundesliga teil. Mit dem Aufstieg in den "bezahlten Fußball" hat es allerdings erst geklappt, als der DFB einen neuen Unterbau einführte: Die 2.Bundesliga. Im Weltmeisterschaftjahr 1974 stiegen die Braun-Weißen gemeinsam mit Eintracht Braunschweig auf.
Elf Jahre diente die fünfgleisige Regionalliga als zweithöchste Spielklasse unterhalb der 1963 geschaffenen Bundesliga. Mit einem 4:1-Sieg über den VfL Wolfsburg wurde am 10.November 1963 das "neue" Stadion am Millerntor zum zweiten Mal eingeweiht. Unter dem neuen Trainer Otto Westphal sicherte sich der FC St. Pauli gleich in der ersten Saison den Meistertitel der Nord-Staffel, im Folgejahr reichte es hinter Holstein Kiel nur zum 2.Platz, um in der dritten Spielzeit 1965/66 wiederum als Meister Göttingen 05 und die Kieler hinter sich zu lassen.
In den Spielzeiten von 1966 bis 1969 erreichte man zunächst den fünften Rang und verbesserte sich in folgenden Jahren stets um einen Platz in der Abschlusstabelle. Unter Trainer Erwin "Ata" Türk begann im Sommer 1968 der Umbruch. Ältere Spieler wie Ingo Porges beendeten ihre Karriere, neue junge Spieler kamen ans Millerntor. Auch in der folgenden Saison stießen weitere junge Talente dazu. Alfred Hußner (19 Jahre), Horst Wohlers (20) oder auch Herbert Liedtke (18) wuchsen umgehend zu den Stützen des Teams.
Ein interner "Skandal" überschattete jedoch den Saisonauftakt: Bereits Ende Juli schied die Türk-Elf im DFB-Pokal gegen das eigene Amateurteam aus. Peter Darsow erzielte den einzigen Treffer der Partie, gegen deren Wertung die Liga-Mannschaft sogar Protest einlegte. Angeblich seien drei Amateur-Kicker nicht spielberechtigt gewesen.
Dennoch spielte der FC St. Pauli eine klasse Saison, erreichte am Ende 1969/70 allerdings einen doch enttäuschenden 4.Platz. In den darauffolgenden Spielzeiten nahmen die Braun-Weißen dreimal nacheinander an der Aufstiegsrunde teil, doch musste man 70/71 Neunkirchen und Düsseldorf den Vortritt lassen. 1971/72 schaffte der FC den 1.Platz, schloss die Aufstiegsrunde allerdings hinter RWE und Kickers Offenbach ab. Auch 1972/73 gelang erneut die Meisterschaft, doch scheiterte man ebenso erneut in der Aufstiegsrunde; Fortuna Köln gelang der Sprung in die 2.Bundesliga.
1973/74 wurde die Millerntor-Elf hinter Braunschweig Zweiter und qualifizierte sich für die neu gegründete 2.Bundesliga Nord. In 36 Begegnungen trafen die Kiezkicker 113 mal in Schwarze – bis Heute der absolute Vereinsrekord! Dazu trugen Kantersiege gegen Phoenix Lübeck und Heide (je 8:0) und Bremerhaven (9:0) ebenso bei wie Franz Gerber, der in 31 Partien 33 Treffer erzielte und vor der ersten Zweitliga-Saison zum Wuppertaler SV wechselte.

Nach elf Jahren Regionalliga ging es 1974 endlich in den "bezahlten" Fußball, 1977 gelang sogar der Aufstieg in die Bundesliga. Es folgte der direkte Wiederabstieg und nur ein Jahr später der Lizenzentzug.
1974/75
Kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft 1974 im eigenen Land, schaffte der FC St. Pauli gemeinsam mit Eintracht Braunschweig den Aufstieg aus der Regionalliga Nord. Drei Tage vor Weihnachten wurde der VfL Wolfsburg am Millerntor mit 10:2 abgefertigt, - dem höchsten Heimsieg der Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel nach 1945. Als Aufsteiger schloss der FC St. Pauli die Saison 74/75 überraschend als Tabellendritter hinter Meister Hannover 96 und Uerdingen ab, fast hätte es zum Durchmarsch gereicht.
1975/76
Wieder einmal bewahrheitete sich das Sprichwort, dass das Zweite Jahr immer das schwerste ist, denn nur mit Mühe und Not wurde in der folgenden Spielzeit der Abstieg verhindert. Am Ende der Saison 1975/76 stand der FC auf einem unbefriedigenden 14.Tabellenplatz in der 20 Teams umfassenden 2.Liga, doch war das wichtigste Vereinsziel erreicht: Der Klassenerhalt. Vereine wie Spandauer SV, DJK Gütersloh, Wacker 04 Berlin oder auch die SpVgg Erkenschwick hießen die damaligen Gegner, die man in der Tabelle hinter sich ließ. Zwar hatte die Millerntor-Elf mit 70 Toren annähernd so viele Treffer erzielt, wie die Mannschaften im oberen Tabellendrittel, nur hatte sie dabei leider auch 82 Gegentreffer kassiert. Zu den Aufsteigern zählten damals zwei Borussen-Teams; TeBe Berlin und die Dortmunder, die sich in den Relegationsspielen gegen den 1.FC Nürnberg durchsetzten.
1976/77
Nachdem Uli Hoeneß im Sommer einen nicht gänzlich unbedeutenden Elfmeter in den Belgrader Nachthimmel bugsiert hatte, stand für die Millerntor-Elf die dritte Zweit-Liga-Saison an und sie sollte großes bringen: Den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 1.Liga! 19 Siege, 16 Remis und nur drei Niederlagen standen am Ende zu Buche. Doch ausschlaggebend für die Platzierungen an der Spitze, war eine Serie von 27 (!) ungeschlagenen Spielen. Der Start verlief allerdings nicht nach Maß: Einer 0:1-Niederlage in Wuppertal folgten gleich vier Unentschieden, bevor Anfang September Alemannia Aachen am Millerntor mit 3:1 bezwungen wurde. Fortan gewann die Elf von Neu-Trainer Diethelm Ferner alle Heimspiele, bis zum 2.Weihnachtsfeiertag, als es (wieder einmal) gegen Wuppertal ging. 2:2-Remis trennte man sich vom WSV. Nur in Bielefeld und Herne verlor der FC in dieser Saison und am 7. Mai 1977 schoss Niels Tune-Hansen mit seinem 1:0-Siegtreffer beim SC Herford die Kiezkicker zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga.
1977/78
Die Erwartungen waren teilweise riesig bis absolut irreal, und nach dem ersten Spiel gab es durch einen 3:1-Sieg über Werder Bremen (Tore 2x Demuth, Gerber) weiteren Nährboden für alle Phantasten. Schnell wurde die Ferner-Elf allerdings wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, denn der FC Bayern gab sich am 2.Spieltag beim 4:2 (Tune-Hansen, Gerber) keine Blöße. Zuhause unterlag man Braunschweig knapp (0:1) und in Saarbrücken sogar mit 0:4, bevor gegen Schalke immerhin ein Unentschieden (1:1, Neumann) geholt wurde. Danach kam das absolute Saisonhighlight, welches bis heute unvergessen ist: Am 3.September gelang der legendäre 2:0-Auswärtserfolg beim HSV. Franz Gerber und Wolfgang Kulka gingen mit ihren Treffern in die braun-weiße Geschichte ein und ein kleiner elfjähriger Steppke erklärte seinem Vater anschließend: "Papa, nächste Woche geh‘ ich aber zu den Braun-Weißen", was zu - bis heute nicht ausräumbaren - erheblichen innerfamiliärer Differenzen führte... Eine Woche später vergeigte man das Heimspiel gegen Dortmund auf geradezu groteske Art und Weise: Lagen die Kiezkicker bereits zur Pause 0:3 hinten, so markierte Erwin Kostedde kurz nach dem Wiederbeginn innerhalb von 50 Sekunden zwei weitere Treffer für die Schwarz-Gelben. Neumann, Höfert und Kulka verkürzten noch auf 3:5, bevor Vöge den Endstand herstellte. Bei Gladbach verlor man knapp mit 1:2 (Gerber), am 9.Spieltag gelang durch einen "lupenreinen Hattrick" von Franz Gerber ein glatter 3:0-Sieg. Zweimal Kulka und Feilzer trafen bei der 3:4-Niederlage beim MSV Duisburg, bevor es gegen 1860 wieder einen Sieg zu bejubeln gab. Neumann, Gerber und zweimal Höfert markierten die Treffer zum 4:1-Erfolg. In den verbleibenden sechs Partien der Hinrunde gab es nur einen Sieg (2:1 gegen Düsseldorf, Oswald, Sturz) und lediglich ein 1:1 (Gerber) gegen den VfL Bochum. Die Spiele gegen Frankfurt, Kaiserslautern, Stuttgart und Köln gingen allesamt verloren. Die Rückrunde begann im Dezember mit einer deutlichen 0:4-Niederlage in Bremen, gegen die Bayern gelang immerhin ein torloses Remis. Im Januar 1978 setzte es nur Niederlagen: 0:2 in Braunschweig, 1:3 gegen Saarbrücken, 1:4 bei Schalke und das Derby ging mit 2:3 an die Rautenträger. Im zweiten Monat des Jahres reichte es zunächst für ein 1:1 in Dortmund (Gerber), dann setzte sich die Negativserie fort: Die Hertha revanchierte sich für die Hinspielpleite mit einem deftigen 5:0-Sieg, gegen den MSV gab es nur ein 2:2 (Demuth, Beverungen) und bei 1860 verlor man mit 1:4 (Frosch). In den verbleibenden sechs Saisonspielen gab es neben dem tollen 5:3 über Eintracht Frankfurt (Beverungen, 2x Sturz, Oswald und Gerber waren die Torschützen), nur noch das 1:1 gegen den VfB Stuttgart, - die restlichen Begegnungen waren nicht von Erfolg gekrönt. In Kaiserslautern 1:2-Niederlage (Milardovic), 0:4 in Bochum, und 1:3 bei Fortuna Düsseldorf. Mit der 0:5-Heimspielpleite gegen den Meister 1.FC Köln endete das "Abenteuer Bundesliga" für die Millerntor-Elf nach nur einer Saison.
1978/79
Nach dem Abstieg aus der Bundesliga erreichte der FC St. Pauli am Ende der 2.Liga-Saison immerhin den 6.Tabellenplatz, dennoch mussten die Braun-Weißen nach dem Lizenzentzug in der Amateur-Oberliga-Nord antreten.
Nach dem Lizenzentzug musste am Millerntor etwas passieren. Zunächst traten Ernst Schacht und Max Uhlig zurück, Wolfgang Kreikenbohm wurde Präsident, Otto Paulick und Hans-Georg Rektor als Vize gewählt. Der Neuaufbau konnte beginnen.
1979/80
Beim FC St. Pauli war zu der Zeit viel Provisorium: Ein zusammen gewürfelter Haufen aus A-Jugendlichen und Amateurkickern bildete zunächst die Mannschaft, die von Liga-Obmann Werner Prokopp trainiert wurde. In klapprigen Kleinbussen, die von den Spielern teils selbst gelenkt wurden, reiste man zu Auswärtsspielen. Auch fianzierten Fans öfters die Anreise, indem sie dafür bezahlten, dass sie im "Mannschaftsbus" mitfahren durften.
Im Herbst 1979 übergab Prokopp sein Traineramt an Kuno Böge, der zuvor Holstein Kiel in der 2.Liga gecoacht hatte. Etliche Niederlagen ließen die Saison aber zu einer Nerven aufreibenden werden, erst Mitte April stand der Klassenerhalt fest. Der überragende Neuzugang Uwe Mackensen sicherte beim 4:2-Sieg über Salzgitter ein weiteres Oberligajahr.
1980/81
Joachim Philpkowski wechselte von Barmbek-Uhlenhorst ans Millerntor und schlug als Stürmer auf der linken Außenbahn wie eine Bombe ein. Neben Karp und Rietzke kam Volker Ippig als dritter Torhüter dazu, der im April mit der A-Jugend ein Freundschaftsspiel am Millerntor austrug. Gegner war die von Jupp Derwall trainierte Nationalmannschaft.
Nach dem 10. Platz im Vorjahr sicherte man sich nun die Meisterschaft mit 68:28 Toren und 50:18 Punkten vor Werder Bremen. Doch der Aufstieg blieb dem FC St. Pauli auf Grund der Einführung der eingleisigen 2.Bundesliga verwehrt.
Immerhin erreichte das Millerntor-Team das Finale um die Deutsche Amateurmeisterschaft. Doch ging das Endspiel in Köln gegen die Amateure des heimischen 1. FC mit 0:2 verloren.
1981/82
Mit den Zweitliga-Absteigern Holstein Kiel, Göttingen 05, dem VFB Oldenburg sowie dem OSV Hannover hatte St. Pauli harte Konkurrenz bekommen. Trainer Böge verließ den Verein nach der Winterpause und Ersatz-Keeper Michael Lorkowski übernahm das Traineramt. Mit ihm wurde der Club am Saisonende Sechster.
1982/83
Ein erneuter Umbruch stand bevor. Ältere Spieler wie Walter Frosch wechselten u.a. zu Altona 93. Hinzu kamen junge Kicker wie Stefan Studer und Michael Dahms. Um die Routiniers Jens-Peter Box und Uwe Mackensen baute Lorkowski ein neues Team auf, welches im Laufe der nächsten Jahre für Furore sorgen sollte.
Als Entschädigung für den entgangenen Aufstieg als Oberligameister von 1981 spendierte der DFB eine Reise nach Afrika. In deren Rahmen kickten die Braun-Weißen in Kenia, Tansania und Somalia. Am Saisonende erreichte das junge Überraschungsteam mit 12 Punkten Vorsprung souverän die Meisterschaft, doch in der Aufstiegsrunde wurde deutlich, das die jungen Hüpfer (das Durchschnittsalter der Mannschaft betrug 22,3 Jahre) überfordert waren. So gingen alle drei Auswärtspartien verloren. So stand ein weiteres Jahr in der Oberliga Nord an.
1983/84
Daheim feierte der FC berauschende Siege. Auswärts dagegen offenbarte man stets eine unerklärliche Schwäche. Erst in der Rückrunde gab es beim späteren Meister Werder Bremen einen sensationellen 7:0-Erfolg. Als Tabellenzweiter nahm der FC St. Pauli gemeinsam mit dem SV Lurup an der anstehenden Aufstiegsrunde teil. Am Ende stieg die Lorkowski-Elf in die 2.Liga auf.
1984/85
Nach einer peinlichen 1:5-Klatsche am Millerntor stand der FC am 5.Spieltag auf einem deprimierenden 18.Tabellenplatz. Nach der 3:1-Pleite in Homburg ging es sogar auf den vorletzten Rang der 20 Vereine umfassenden Liga. So wurden Didi Demuth und Peter Nogly kurzerhand ans Millerntor geholt Beide trumpften in ihrem ersten Spiel gemeinsam mit dem von Werder gekommenen Matthias Ruländer groß auf, St. Pauli gewann 3:0 gegen Darmstadt 98. Fünf Tage zuvor wählte die Mitgliederversammlung Heinz Weisener als Vize ins Präsidium des FC St. Pauli.
Kaum ein Spieltag verging, an dem die Kiezkicker nicht im Tabellenkeller dümpelten. Am Ende reichte es nicht. Ein Punkt und zehn Treffer trennte die Braun-Weißen vom rettenden 16.Platz. Der FC St. Pauli musste nach nur einem Jahr wieder in die Oberliga zurück.
1985/86
Nach dem Abstieg aus der 2.Liga blieben die Fans dem Club treu. Der Schnitt von 4000 Zuschauer aus der abgelaufenen Saison wurde beinahe gehalten. Die Mannschaft stand nach der Hinrunde hinter Oldenburg ganz oben und so blieb es auch bis kurz vor Schluss. Nach einem 1:0-Erfolg über den alten Rivalen Altona 93 übernahm der FC die Tabellenspitze und wurde souverän Meister.
In der Aufstiegsrunde waren Vereine wie Charlottenburg und Schöppingen keine ernsthaften Gegner. Das vorletzte Gruppenspiel gegen Rot-Weiß Essen brachte die Vorentscheidung: Didi Demuth, Andre Golke und Jürgen Gronau erzielten die Treffer zum souveränen 3:0-Sieg. Als Sieger der Nord-Gruppe war man zurück in der 2.Bundesliga.
1986/87
Michael Lorkowski wechselte zu Holstein Kiel, sein Nachfolger hieß Willi Reimann – bislang Trainer bei Altona 93. Bereits im ersten Saisonspiel wurde beim 4:2-Sieg über Meisterschaftsfovoriten Saarbrücken deutlich, dass der Aufsteiger durchaus zu bestehen wusste. Franz Gerber kehrte zum zweiten Mal ans Millerntor zurück und wusste trotz seiner 33 Jahre zu überzeugen.
In der ersten DFB-Pokalrunde siegte die Reimann-Elf sensationell beim VfL Bochum mit 2:1. Nach dem Aus in der 3.Runde gegen den Hamburger SV bewahrheitete sich der Spruch, dass „die Mannschaft sich nun voll auf die Liga konzentrieren kann“. Denn danach gab es eine Serie von 12 ungeschlagenen Spielen. Am Ende fand ein überraschender 3.Platz Eintrag in die Fußballstatistik. Die Relegation gegen den Drittletzten der 1.Liga Homburg, ging dann aber leider verloren (1:3, 2:1), sodass eine weitere Saison als Zweitligist anstand. Allerdings wäre der Aufstieg mehr als überraschend und vielleicht auch zu früh gewesen.
1987/88
"Der 29. Mai 1988. Es ist 15:30 Uhr. Der entscheidende Tag. Die entscheidende Minute. St. Pauli spielt in Ulm die 38. Und letzte Partie der Saison. Einen Punkt brauchen die Schulte-Männer – dann sind sie drin. Aber sie wollen zwei. Wollen auf Nummer sicher gehen. Also stürmen sie. So, wie es Helmut Schulte im Hotel Stern angesagt hatte: 'Männer, nicht verkriechen. Stürmt! Schießt! Habt Mut! Ich weiß es – wir steigen auf!' Also, 15:30 Uhr. Einer hat genau zugehört. Dirk Zander. Jetzt um 15:30 Uhr, das ist seine Minute. Andre Golke spielt ihn frei, Zander jagt durchs Mittelfeld, sieht die günstige Schussposition, sieht die Lücke. Zieht aus 25 Metern volley ab. Ein Schuss, ein Strich – was für ein Tor! In den oberen Torwinkel schlägt der Ball – die Führung, der Sieg, der Aufstieg!"
So beschreiben Uwe Dulias und Michael Schickel in ihrem 1989 erschienen Buch "1:0 am Millerntor – Der FC St. Pauli: Die Fans und ihre Mannschaft", den zweiten Aufstieg der Kiezkicker in die höchste deutsche Spielklasse. Nach dem Abstieg 1978 und dem späteren Lizenzentzug, all den Jahren zwischen Ober- und Zweiter Liga mit den vielen verlorenen Aufstiegsspielen, - endlich hatte der Fußballgott ein Einsehen und ließ die Jungs vom Millerntor wieder mit den Großen spielen. Als Tabellenzweiter war man gemeinsam mit den Stuttgarter Kickers aufgestiegen und die Jubelorgien dauerten mehrere Tagen.
Mehr ist zu dieser Saison eigentlich nicht zu sagen...
Mitte November 1988 hatte Coach Reimann den Kiez verlassen und wechselte zum Lokalrivalen in den Volkspark. Helmut Schulte, bislang Co-Trainer übernahm den Job.
Bereits am vorletzten Spieltag war der Aufstieg eigentlich schon in trockenen Tüchern. Durch Treffer von Dirk Zander und Hansi Bargfrede wurde Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0 besiegt. Nur ein Punkt im letzten Spiel in Ulm und alles wäre hundertprozentig! Diese Aussicht veranlasste die St. Pauli-Fans zu einem Autokorso samt Hupkonzert und etlichen vorgezogenen improvisierten Aufstiegsfeierlichkeiten in diversen Kneipen rund ums Millerntor. Der Rest ist Geschichte.
Andre Golke, Fan, Ralf Sievers. Foto aus "Wunder gibt es immer wieder" von René Martens

"Der 29.Mai 1988. Es ist 15.30 Uhr. Der entscheidende Tag. Die entscheidende Minute. St. Pauli spielt in Ulm die 38. Und letzte Partie der Saison. Einen Punkt brauchen die Schulte-Männer – dann sind sie drin. Aber sie wollen zwei. Wollen auf Nummer sicher gehen. Also stürmen sie. So, wie es Helmut Schulte im Hotel „Stern“ angesagt hatte: ‘Männer, nicht verkriechen. Stürmt! Schießt! Habt Mut! Ich weiß es – wir steigen auf!‘.
Also, 15.30 Uhr. Einer hat genau zugehört. Dirk Zander. Jetzt um 15.30 Uhr, das ist seine Minute. Andre Golke spielt ihn frei, Zander jagt durchs Mittelfeld, sieht die günstige Schussposition, sieht die Lücke. Zieht aus 25 Metern volley ab. Ein Schuss, ein Strich – was für ein Tor! In den oberen Torwinkel schlägt der Ball – die Führung, der Sieg, der Aufstieg!".
1988/89 - Aufstieg und Klassenerhalt
So beschreiben Uwe Dulias und Michael Schickel in ihrem 1989 erschienen Buch "1:0 am Millerntor – Der FC St. Pauli: Die Fans und ihre Mannschaft", den zweiten Aufstieg der Kiezkicker in die höchste deutsche Spielklasse. Nach dem Abstieg 1978 und dem späteren Lizenzentzug, all den Jahren zwischen Ober- und Zweiter Liga mit den vielen verlorenen Aufstiegsspielen, - endlich hatte der Fußballgott ein Einsehen und ließ die Jungs vom Millerntor wieder mit den Großen spielen. Als Tabellenzweiter war man gemeinsam mit den Stuttgarter Kickers aufgestiegen und die Jubelorgien dauerten mehrere Tagen.
Doch in der 1.Liga angekommen, spürte die Schulte-Elf gleich im ersten Spiel den etwas raueren Wind der Eliteklasse. 0:1 im ersten Spiel vor heimisches Publikum gegen den 1.FC Nürnberg. Eine Woche später der erste Punkt beim 0:0 in Bochum, im zweiten Heimspiel gelingt der erste Sieg – 2:0 (Tore: Flad, Kocian) über Eintracht Frankfurt. "Wir haben für unseren Präsidenten Otto Paulick gespielt!", gibt das Team anschließend einstimmig zu Protokoll. Paulick war in den Wochen zuvor vom Vize Hellmut Johannsen schwer beschuldigt worden: "Unsolide Haushaltsführung", hieß der Hauptvorwurf. Und: Der Verein wäre zu weit überschuldet.
Die 1:3-Pleite (Tor: Steubing) beim KSC stecken Gronau, Zander, Golke und Co. prima weg, lassen Zuhause einen 2:1-Sieg (Golke, Gronau) über den VfB Stuttgart folgen und trotzen dem HSV im Volksparkstadion ein 1:1-Unentschieden (Kocian) ab.
Es folgen mit dem 1:1 gegen Kaiserslautern (Duve), 2:2 in Leverkusen (Steubing, Ottens), 0:0 bei Werder und 1:1 gegen Gladbach (Gronau) vier Remis, bevor Dortmund am Millerntor mit 1:0 (Golke) besiegt wird.
Erneut gibt es eine kleine Serie von Unentschieden: Zunächst das beinahe unglückliche 2:2 in Hannover (Bargfrede, Gronau), dann das bemerkenswerte 0:0 gegen die großen Bayern, bevor es bei den Stuttgarter Kickers 2:2 endet (Olck, Gronau).
Nach einem 2:1 (Bockenfeld - Eigentor, Wenzel) über Waldhof Mannheim, setzt es beim 0:1 gegen den 1.FC Köln die zweite Saisonniederlage. Mit dem 0:0 bei Bayer Uerdingen holt sich die Millerntor-Elf nach der Hinrunde den 10.Tabellenplatz.
In der Rückrunde wechselten sich Licht und Schatten regelmäßig ab, Spiele gegen Gegner, die man in der Hinrunde geschlagen hatte, verlor man – und umgekehrt. Doch zunächst begann es wie es anfing – mit einer Niederlage gegen Nürnberg (Tore im Frankenstadion: Golke, Flad, Brunner- Eigentor). 3:2 führte man zur Pause, um dann noch 3:5 unterzugehen.
1:0 (Zander) daheim gegen Bochum, 1:1 (Flad) in Frankfurt. Dann wieder ein 1:0-Sieg (Zander) am Millerntor gegen den KSC, bevor man beim VfB Stuttgart mit 1:2 (Golke) unterlag. Mit demselben Ergebnis verlor die Millerntor-Elf ihr "Heim"spiel gegen den HSV (Tor: Wenzel), auch in Lautern vergeigten die Schulte-Mannen, bevor im Heimspiel gegen Leverkusen endlich wieder ein 2:0-Sieg (Zander, Dahms) bejubelt werden konnte.
Erneut nur Remis gegen Gladbach (2:2, Golke, Wenzel), und eine 1:3-Heimpleite (Flad) gegen Werder, anschließend zwei Unentschieden in Dortmund (0:0) und gegen Hannover (1:1, Zander). Danach ging es in Münchner Olympiastadion, doch die Bayern siegten 2:1 (Duve).
Zuhause wurden die Kickers aus Stuttgart knapp aber verdient mit 1:0 (Zander) geschlagen, bevor es in Mannheim (1:2, Zander) und Köln (2:4, Golke, Großkopf) zwei Niederlagen setzte.
Am letzten Spieltag gab man vor über 16.000 Zuschauern noch einmal alles und bedankte sich bei den Fans mit einem tollen 5:1 über Uerdingen für die Unterstützung. Dreimal war Andre Golke erfolgreich, Jens Duve und Dirk Zander besorgten die weiteren Treffer und so stand der FC St. Pauli auf dem 10.Tabellenplatz (die beste Platzierung bislang), - die Stuttgarter Kickers stiegen direkt wieder ab. Auf die Kiezkicker wartete eine weitere Saison in der 1.Liga, und diese sollte es ebenso in sich haben, wie die abgelaufene...
1989/90 – Das zweite Jahr ist immer das schwerste
Zweimal unterlag man den Bayern, zweimal gab es gegen den HSV ein torloses Remis und es gab die höchste Saisonniederlage aller Zeiten – 0:7 am letzten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf, gleichzeitig das Abschiedsspiel für Rüdiger "Sonny" Wenzel.
Mit drei Niederlagen und drei Remis startete man in diese Spielzeit, bevor es am 8.Spieltag den ersten Sieg gab: 1:0-Sieg bei Waldhof Mannheim. Höhepunkte waren sicherlich die Siege über Dortmund und Gladbach (jeweils 2:1) und Bayer Leverkusen, das sogar mit 3:0 nach Hause geschickt wurde.
Am Saisonende stand der 13.Rang zu Buche und man ließ Uerdingen, Gladbach und Bochum hinter sich, absteigen mussten Mannheim und Homburg.
1990/91 – Sieg bei Bayern und Tränen auf Schalke
Auch wenn am Ende der Abstieg besiegelt war, - diese Spielzeit bleibt den St. Paulianern schon allein auf Grund der Spiele gegen die Bayern sicherlich auf ewig unvergessen. Am ersten Spieltag siegten die Kiezkicker bei der Berliner Hertha mit 2:1 und bereits am 2.Spieltag trotze man den Bayern nach großem Spiel am Millerntor ein torloses Remis ab.
Am 2.März 1991 war es dann soweit: In der 43.Minute schickte Ivo Knoflicek seinen Mannschaftskollegen Ralf "Colt" Sievers auf die Reise, dieser tankte sich durch die Münchner Defensivabteilung und ließ bei seinem trockenen Torschuss Bayern-Keeper Raimond Aumann nicht den Hauch einer Chance – ein historischer Sieg!
Nur sechs Siege, dazu 13 Niederlagen und 15 Remis, - das reichte am Ende nur für Platz 16 und dies bedeutete, dass man in die Relegation musste. Gegner dort waren ausgerechnet die Stuttgarter Kickers. Nach einem mageren 1:1 am Millerntor begleiteten eine Woche später über 3000 Fans den FC St. Pauli ins Schwabenland. Abermals konnte keines der beiden Teams den Aufstieg klar machen, erneut trennte man sich 1:1 unentschieden.
Schätzungsweise 15.000 St. Pauli-Fans erlebten dann beim Entscheidungsspiel auf Schalke einen tränenreichen Abschied aus der Bundesliga. Beinahe wäre nach der 1:3-Pleite Hochwasseralarm in Gelsenkirchen ausgelöst worden...
Gemeinsam mit Uerdingen und Hertha BSC ging es nach drei Jahren zurück ins Unterhaus des Fußballs. Doch bereits auf der Rückfahrt wurden die ersten Pläne für einen Sonderzug nach Meppen geschmiedet...
Franz Gerber, Sonny Wenzel, Andre Golke im Freudenhaus der Liga. Foto aus "1:0 am Millerntor" (Dulias/Schicke)

Nach drei Jahren im Oberhaus hieß es wieder "Bonjour tristesse, hallo Zweite Liga". Vier lange Jahre sollte es dauern, bis die Kiezkicker wieder die Bundesliga mit ihrer Anwesenheit bereicherten. Für zwei Spielzeiten gab es wieder Kräftemessen mit den Bayern und dem Lokalrivalen aus Stellingen.
1991/92 – Wiederaufstieg weit verfehlt
"Wir sind nicht der Hecht im Karpfenteich, sondern die Piranhas. Wir fressen alles auf", erklärte St. Paulis Manager Herbert Liedtke vor der Saison, doch die Kiezkicker sollten öfters gefressen werden. Nach der politischen Wiedervereinigung wurde auch Fußball-Deutschland reformiert. Die Zweite Liga war in Nord- und Südgruppe geteilt, jeweils zwölf Teams spielten in der Vorrunde zunächst eine sechsköpfige Auf- bzw Abstiegsrunde aus. In der Nordstaffel war mit Stahl Brandenburg nur ein ehemaliger Ostverein dabei, neben den Kiezkickern mit Hertha und Uerdingen aber auch alle drei Bundesliga-Absteiger.
Am Ende der Vorrunde stand der FC St. Pauli Mitte Dezember hinter Uerdingen und Hannover 96 an dritter Stelle, die Teilnahme an der Aufstiegsrunde war gesichert. Es folgten Spiele mit Berg- und Talfahrt-Charakter: Glückliche Siege, überraschende Remis, vermeidbare Niederlagen. Zunächst unterlagen die Kiezkicker 1:2 bei Hertha, es folgte des 1:0-Sieg über den SV Meppen, die Partie beim VfB Oldenburg ging mit 0:2 verloren. Der erste Tiefpunkt dann am 28. März bei der 0:3-Heimniederlage gegen Hannover 96. Beim 1:1 in Uerdingen wurde wieder ein Punkt geholt, doch mit der 0:3-Heimniederlage gegen Hertha am 11. April waren fast sämtliche Aufstiegschancen verspielt worden.
Dann plötzlich wieder ein 2:0-Erfolg in Meppen und der 3:2-Heimsieg gegen Oldenburg. Nach 2:0-Auswärtserfolg bei Hannover gab es nochmals einen kleinen Hoffnungsschimmer, stand man doch wieder auf dem 4. Platz. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Uerdingen blieb am Ende nur der 4. Tabellenplatz für den FC St. Pauli. Uerdingen stieg auf.
1992/93 – Die Mammut-Saison
Nach dem einjährigen Intermezzo mit zwei Staffeln, verschmolzen die Nord- und Südgruppe zu einer 24 Mannschaften umfassenden Liga. 46 Saisonspiele waren somit zu absolvieren, weshalb der Saisonstart bereits zwei Wochen nach dem EM-Finale von Göteburg am 11.Juli erfolgte. Fast elf Monate später, am 6.Juni fand diese einmalig lange Spielzeit ihr Ende. Trainer Michael Lorkowski wurde bereits im September von seinem bisherigen Assistenten Seppo Eichkorn abgelöst, der den FC St. Pauli mit nur 12 Siegen, 19 Remis und 15 Niederlagen immerhin noch auf den 17. und damit letzten Nichtabstiegsplatz führte. Freiburg, Duisburg und Leipzig hießen die Aufsteiger in die Bundesliga.
1993/94 – Knapp daneben ist auch vorbei
Mitte Oktober belegte der FC St. Pauli einen enttäuschenden 15.Tabellenplatz, startete dann allerdings eine Serie mit 18 ungeschlagenen Spielen und kletterte bis zum 32.Spieltag auf den 2.Rang. In den verbleibenden sieben Partien verspielte man den möglichen Aufstieg. Nur zwei Siegen standen fünf Niederlagen gegenüber. Die bitterste sicherlich am letzten Spieltag vor über 10.000 St. Pauli-Fans in Wolfsburg beim 1:4. Mit zwei Punkten Rückstand landete der FC auf dem enttäuschenden vierten Rang und verpasste abermals den Aufstieg.
1994/95 – Masloismus am Millerntor
Im Sommer musste Eichkorn seinen Hut nehmen, Uli Maslo kam ans Millerntor. In dieser Saison ging nicht ein Heimspiel verloren! Jens “Gerdl” Scharping schaffte es in seinem ersten Profijahr mit zwölf Treffern unter die Top Ten der Torjäger, Juri Sawitchew erzielte weitere 10 Tore. Endlich verfügte der FC über soetwas wie eine Torfabrik. Dabei begann die Saison mit einem klassischen Fehlstart ohne Sieg und mit nur mageren 3:7 Punkten. Dann folgte Ende September in Düsseldorf der erste Saisonsieg. Zwei Wochen später wieder ein Auswärtserfolg in Saarbrücken und am 14.Oktober endlich der erste Heimsieg: 4:1 über Wattenscheid. Martin Driller, Oliver Schweißing, Bernd Hollerbach und Juri Sawitschew markierten die Treffer. Plötzlich schien der Bann gebrochen. Nach Siegen über Mainz, FSV Frankfurt und Homburg stand die Maslo-Elf nach der Hinrunde hinter dem VfLWolfsburg auf dem 2.Tabellenplatz, gefolgt von der Düsseldorfer Fortuna.
Auch im DFB-Pokal spielte man erfolgreicher denn je: Nach Siegen bei Union Berlin (3:2), TeBe Berlin (4:3) und Saarbrücken (4:1) schied das Team von Uli Maslo erst im Viertelfinale beim 1.FC Kaiserslautern (2:4) aus.
Im ersten Spiel der Rückrunde gegen den Spitzenreiter gab es wie zuvor ein Unentschieden. Nur die Begegnungen in Mannheim, Leipzig und Chemnitz gingen verloren, dazu eine kleine Serie von fünf Unentschieden: Der FC St. Pauli war auf dem besten Weg zum dritten Bundesliga-Aufstieg. In den verbleibenden drei Partien erzielten die Kiezkicker 13:1 Tore! 5:0 über den FSV Zwickau, 3:1 in Frankfurt und erneut ein 5:0 über Homburg. Doch gerade dieses letzte Saisonspiel wird den dabei gewesenen 21.000 Zuschauern ewig in Erinnerung bleiben. Nicht wegen des hohen Ergebnisses. Ein Pfiff des Schiedsrichters Bodo Brandt-Cholle in der 88. Minute wurde von der bereits feiernden Masse als Schlusspfiff gedeutet und der Heilige Millerntor-Rasen gestürmt. Minutenlange Ungewissheit, nachdem Stadionsprecher Rainer Wulff mit seiner Durchsage "Das Spiel ist noch nicht beendet" für Verwirrung gesorgt hatte. Was wäre, wenn auf Grund des Platzsturms das Spiel anders gewertet würde – war der sicher geglaubte Aufstieg dahin? Bleierne Fassungslosigkeit bei den Fans, bis die klärenden Worte des Unparteiischen verkündet wurden: "Meine Gestik mag missverständlich gewesen sein, doch mein Pfiff beendete die Partie ordnungsgemäß". Ende gut, alles gut! Es dauerte eine Weile bis die Aufstiegsfeier sich in eine typische St. Pauli-Paaadie wandelte. Rund 50.000 Menschen feierten ausgiebig auf dem Spielbudenplatz das Verlassen der ungeliebten "DSF-Liga".
1995/96 – Zurück in der Bundesliga
Mit dem von Maslo propagierten 3-3-3-1-System erhielt das FC-Spiel Qualität, die vor allem in den Spielen in Gladbach (4:2-Sieg) und Uerdingen (5:2) eindrucksvoll zur Geltung kam. Doch schon der Saisonauftakt sorgte für eine Euphorie wie zuletzt in den Jahren zwischen 1988 und 1990: Gleich zu Beginn wurden die Münchner Löwen am Millerntor mit 4:2 besiegt, nur sechs Tage darauf wurde der SC Freiburg an der Dreisam 2:0 geschlagen, - der FC St. Pauli stand hinter den großen Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz!
Nach der Hinrunde standen die Braun-Weißen nach je fünf Siegen und Remis, sowie sieben Niederlagen dennoch auf einem akzeptablen 9. Tabellenrang. Manager Jürgen Wähling geriet mit Maslo aneinander, Wähling musste gehen. Zu spät wurde Ex-Trainer Helmut Schulte als dessen Nachfolger verpflichtet, auf dem Transfermarkt herrschte bereits gähnende Leere, notwendige Verstärkungen gab es nicht.
So ist es fast ein Wunder, dass der FC St. Pauli die Klasse hielt. Am Ende der Saison stand man auf dem 15. und damit letzten Nicht-Abstiegsrang, vor Kaiserslautern, Frankfurt und Uerdingen. Somit war ein weiteres Jahr Erstliga-Fußball am Millerntor gesichert.
1996/97 – Die Katastrophen-Saison
Lediglich sieben (davon fünf Heim-) Siege und sechs Remis standen 21 Niederlagen gegenüber. Das reichte am Ende der Saison nicht – St. Pauli stieg als Tabellenletzter in die Zweite Liga ab, begleitet vom SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf.
Bereits am ersten Spieltag hatte man den FC Bayern zu Gast, unterlag den Münchnern im Volksparkstadion knapp mit 1:2. Vier Tage später, an einem Dienstagabend, der erste und für einige Wochen auch der letzte Sieg bei Arminia Bielefeld. Drei Tage darauf zeigte das Maslo-Team gegen Schalke 04 noch einmal ein klasse Spiel. Nachdem man zur Pause bereits mit 1:3 hinten lag, kämpfte sich die Millerntor-Elf wieder heran und kam zu einem respektablen 4:4-Unentschieden.
Bis Anfang November gingen sämtliche Spiele verloren, mit Ausnahme der Partien gegen die beiden späteren Mitabsteiger sowie einem 1:1 gegen den 1.FC Köln Ende September. Kämpferisch und taktisch überzeugend dagegen die Heimpartien gegen den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, welche 2:1 bzw. 3:1 gewonnen wurden. In der Rückrunde wurden bei einem Torverhältnis von 9:39 (!) nur sechs Pünktchen geholt. Der einzige Sieg konnte beim 1.FC Köln errungen werden, glücklich das 2:2 beim HSV – unter tatkräftiger Mithilfe von Rothosen-Keeper Richard Golz: Kurz vor Schluss legte er Nikolai Pisarew den Ball direkt vor die Füße, dieser bediente Jens Scharping, der ins leere Tor einnetzte.
Die letzten sieben Saisonspiele gingen verloren. Nach der 0:4-Klatsche in Freiburg wurde Uli Maslo entlassen. Sein bisheriger Co-Trainer und Nachfolger Ka-Pe Nemet konnte nichts mehr reparieren: 1:18 Tore und null Punkte aus den verbleibenden sechs Spielen. "Eine neue Liga ist wie ein neues Leben", sangen die Fans nach dem 0:6 in Bochum voller ironischer Vorfreude auf die Zweite Liga...
1997/98 – Ein Neuanfang?
Zwei torlose Unentschieden (in Fürth und gegen Gütersloh) zu Saisonbeginn. Im DFB-Pokal das Aus in der ersten Runde nach einer 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen in Jena. In der Liga gab es mit 2:0 über Mainz den ersten Heimsieg, doch gleich in der nächsten Partie beim FSV Zwickau setzte es ein 0:4. Dieses Auf- und Ab setzte sich über die gesamte Saison fort. Trainer Eckhardt Krautzun musste Ende November seinen Hut nehmen, sein Assistent Gerhard Kleppinger übernahm seinen Posten.
Ein gewisser Ivan Klasnic kommt aus der Amateurmannschaft zum Liga-Team. Der gerade 18-jährige Kroate kommt in acht Spielen zum Einsatz, ein Treffer bleibt ihm allerdings verwehrt.
Jeweils 14 Siege und Remis, dazu sechs Niederlagen reichten am Ende dennoch nicht zum Aufstieg. Hinter den Aufsteigern aus Frankfurt, Freiburg und Nürnberg belegten die Kiezkicker nur den vierten Platz. Drei Punkte und fünf Tore fehlten zum Sprung in die erste Liga.
1998/99 – Reimann kehrt zurück
Eine Saison, die man schnell vergessen möchte. Nur jeweils vier Siege und Remis in der Hinrunde, dazu acht Niederlagen. Im Pokal wird zunächst der SV Meppen knapp mit 1:0 geschlagen, beim KFC Uerdingen folgt nach dem 4:5 nach Elfmeterschießen das Aus in der zweiten Runde.
Nach der Winterpause kehrt Willi Reimann als Trainer ans Millerntor zurück und löst "Kleppo" ab. Die nächsten beiden Spiele (beide auswärts) werden gewonnen, insgesamt folgen sieben Siege unter Reimann. Doch erst in den letzten beiden Heimspielen können die Kiezkicker überzeugen, besiegen Düsseldorf (5:0) und die Stuttgarter Kickers (6:2). Mehr als der enttäuschende neunte Tabellenplatz springt nach dieser Saison allerdings nicht heraus. Ganze 13 Zähler beträgt der Abstand zu einem Aufstiegsrang.
1999/2000 – Rettung in letzter Sekunde
In den ersten fünf Spielen gibt es nur zwei torlose Remis, ansonsten setzt es Niederlagen. 3:1 siegt die Demuth-Elf Ende September in Mannheim, der nächste Dreier folgt erst Mitte November beim 2:1-Auswärtssieg bei Hannover 96. Auch im DFB-Pokal ist in der zweiten Runde erneut Schluss für die Braun-Weißen.
Mitte März ist die Zeit von Coach Willi Reimann abgelaufen. Als Nachfolger präsentiert der Verein erneut den bisherigen Co-Trainer: Didi Demuth. Aus den verbleibenden zwölf Spielen holt das Team mit drei Siegen und sechs Remis 15 Punkte.
Am letzten Spieltag glich das einstige Freudenhaus eher einem Trauerhaus, denn gegen Rot-Weiß Oberhausen musste unbedingt ein Remis her. Nach 23. Minuten gingen die Gäste am Millerntor in Führung, doch Marcus Marin bewahrte den FC St. Pauli mit seinem Last-Minute-Treffer zum 1:1-Ausgleich vor dem Abstieg in die Regionalliga. Eine grauenhafte Saison fand einen halbwegs versöhnlichen Abschluss.
Als "Absteiger Nr.1" gehandelt, stiegen die Kiezkicker 2001 zum vierten Mal in die Bundesliga auf. Doch nur für eine Saison, anschließend folgte der freie Fall bis in die Regionalliga...
2000/01 – Der Sensationsaufstieg
Als Absteiger Nummer 1 wurde der FC St. Pauli vor dieser Saison gehandelt. Doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung schaffte man total überraschend den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Besonders herausragend spielten Thomas Meggle, Marcel Rath und Ivan Klasnic, die jeweils über 10 Tore erzielen konnten.
Der Saisonstart versprach schon viel, denn St. Pauli führte die Tabelle nach 2 Spieltagen mit 6 Punkten und sage und schreibe 11:3 Toren an. Am 32. Spieltag schaffte man durch den 1:0 Auswärtssieg in Aachen schon fast den Aufstieg. Ein Sieg am vorletzten Spieltag gegen Hannover und der Aufstieg wäre perfekt gewesen. Doch der FC St. Pauli wäre nicht der FC St. Pauli, wenn man es nicht noch einmal spannend machen würde. Man trennte sich am 33. Spieltag nur 2:2 von Hannover 96 und musste so auf einen Sieg beim Tabellenführer und Mitaufsteiger Nürnberg hoffen. Nürnberg ging schnell in Führung, jedoch gab der Magische FC nie auf und schaffte kurz vor der Halbzeit den wichtigen 1:1 Ausgleichstreffer. In der 76. Minute war es der Aufstiegsheld Deniz Baris, der den FC St. Pauli mit seinem 2:1 in die 1. Bundesliga köpfte. Tausende St. Pauli Fans, die mit nach Nürnberg gereist waren feierten ihre Helden im Stadion und zehntausende Fans auf dem Heiligengeistfeld feierten die Mannschaft nach der Rückkehr aus Nürnberg.
2001/02 – Die Ernüchterung
Nach dem vierten Aufstieg in die 1. Bundesliga, folgte eine katastrophale Saison. Nur vier Spiele konnten in der gesamten Saison gewonnen werden. Am Ende der Saison fehlten letztendlich 12 Punkte zum rettenden Ufer. Jedoch schaffte man einen historischen Erfolg. Am 6. Februar 2002 wurde der aktuelle Meister, der FC Bayern München am Millerntor mit 2:1 bezwungen. Thomas Meggle und Nico Patschinski waren damals die goldenen Torschützen. Dies war leider auch der einzige Höhepunkt in einer verkorksten Saison. Immerhin war der FC St. Pauli von nun an offizieller „Weltpokalsieger-Besieger“.
2002/03 – Der Freie Fall
Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus mussten namenhafte Abgänge wie Thomas Meggle, Zlatan Bajramovic und Marcel Rath verkraftet werden. Dies sollte aber nicht gelingen. Nach einem schlechten Saisonstart mit zwei hohen Niederlagen gegen Frankfurt und Ahlen musste der Trainer Didi Demuth seinen Hut nehmen. Joachim Philipkowski übernahm das Traineramt. Aber auch er konnte den Fall in die Drittklassigkeit nicht verhindern. Außer drei hohen Siegen (7:1 gegen Braunschweig, 5:2 in Mannheim und 4:0 gegen Duisburg) gab es für den FC St. Pauli in dieser Saison nichts zu lachen und so wurde man in die Regionalliga Nord durchgereicht. Jedoch war vorerst gar nicht klar, ob man überhaupt in der nächsten Saison in der Drittklassigkeit spielen würde. Am Ende dieser Saison wies der Verein eine Liquiditätslücke von ca. 1,9 Mio. Euro auf. Um die Lizenz für die Regionalliga doch noch zu bekommen und nicht in die Oberliga strafversetzt zu werden musste der Verein bis zum 11. Juni 2003 dem DFB eine Liquiditätsreserve von 1,95 Mio. Euro vorweisen. Um den Absturz zu entgehen wurden zwei Maßnahmen getroffen. Zum einen wurde das Jugendleistungszentrum am Brummerskamp für 720.000 Euro an die Stadt Hamburg verkauft und zum anderen wurde die „Retter-Kampagne“ ins Leben gerufen. Diese beiden Aktionen wurden von der HSH Nordbank zum 11. Juni mit 1,95 Mio. Euro verbürgt um somit die Erfüllung der Zulassungsbedingungen des DFB fristgerecht zu ermöglichen. Die "Retter-Kampagne" bestand aus dem Verkauf der Retter T-Shirts, einem Benefizspiel gegen Bayern München, aus Spenden, der Kiez-Kneipenaktion "Saufen für St. Pauli" und Kulturveranstaltungen am Millerntor. Durch den unermüdlichen Einsatz von Verein, Fans, Sponsoren und anderen Helfern konnte man den Absturz in die Oberliga gerade noch abwenden.
2003/04 – Der Neuanfang in der Regionalliga
Dass der FC St. Pauli auf seine Fans zählen kann, konnte man auch beim Dauerkartenverkauf für die erste Saison nach langer Zeit in der Regionalliga bewundern. 11.700 Dauerkarten wurden verkauft und somit konnte die Saison euphorisch begonnen werden. Nachdem fast die komplette Mannschaft ausgetauscht worden war, musste der neue Trainer Franz Gerber aus den jungen und neuen Spielern erstmal eine Mannschaft formen. Letztendlich spielt der FC St. Pauli eine durchwachsene Saison. Morad Bounoua war der "Star" des FC St. Pauli in dieser Saison. 11 Tore standen nach der Saison auf seinem Konto, wovon er alleine vier beim 4:0-Heimerfolg über die 2. Mannschaft des 1. FC Köln erzielen konnte. Nachdem man im Frühjahr 2004 nach drei Niederlagen in Folge den Abstiegsrängen bedrohlich nahe kam, trennte man sich von Trainer Franz Gerber und der damalige Amateur-Trainer Andreas Bergmann übernahm die Mannschaft. Am Ende der Saison sprang ein eher enttäuschender Platz 8 heraus und somit musste man sich auf ein weiteres Jahr in der Regionalliga einstellen.
2004/05 – Wieder kein Aufstieg
Auch die zweite Regionalliga Saison brachte nicht den erhofften Aufstieg. Eine weitere durchwachsene Saison wurde auf Platz 7 beendet. In dieser Saison stach besonders Sebastian Wojcik mit seinen 10 Toren hervor, aber auch die Defensivspieler Ralph Gunesch, Florian Lechner und Fabio Morena mauserten sich zu festen Größen des Teams. Trotz des wiederholt verpassten Aufstiegs feierten die FCSP-Fans ihre Mannschaft am letzten Spieltag in Berlin beim Spiel gegen Hertha BSC II, als wäre man aufgestiegen. Dieser Zusammenhalt machte Mut für die nächste Saison.
2005/06 – Die Pokalserie
Nachdem der verlorene Sohn Thomas Meggle aus Rostock ans Millerntor zurückgekehrt war, waren die Erwartungen hoch. Mit ihm sollte nun endlich der erhoffte Wiederaufstieg gelingen. Nach einer recht starken Saison sprang aber leider nur Platz 6 heraus. Jedoch konnte man über diese Saison sagen, dass der FC St. Pauli sich über die gesamte Saison im oberen Tabellendrittel festsetzen konnte und stets zu den besten sechs Teams zählte. Mit Thomas Meggle, Michél Mazingu-Dinzey und Felix Luz konnten auch drei Spieler mindestens acht Tore erzielen. Im DFB Pokal schaffte es der FC St. Pauli sogar ins Halbfinale! Sie starteten die sagenumwobene "B-Serie", wobei man nur gegen Gegner spielte, die mit dem Buchstaben B beginnen (Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen, Bayern). Nachdem in der ersten Runde Wacker Burghausen, ein Zweitligist, denkbar knapp mit 3:2 nach Verlängerung ausgeschaltet worden war, konnte man in der zweiten Runde den VfL Bochum - damals noch ungeschlagener Tabellenführer der 2. Bundesliga - mit einer 4:0-Packung nach Hause schicken.
Im Achtelfinale erwartete der FC St. Pauli die Berliner Hertha am Millerntor. Nachdem die Gäste bereits zur Pause mit 2:0 vorne lagen, glaubte niemand mehr so wirklich an einen Sieg von St. Pauli, doch der Pokal hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Kurz vor Schluss konnte Felix Luz den 2:2-Ausgleich erzielen und es stand die Verlängerung an. Nachdem Hertha BSC dort mit 2:3 in Führung gegangen war, konnte sich der FC St. Pauli in das Spiel zurückkämpfen und erzielte durch ein Tor von Florian Lechner, der wenige Augenblicke zuvor noch mit starken Krämpfen zu kämpfen hatte, kurz vor der Pause der Verlängerung das 3:3. Robert Palikuca köpfte die Kiezkicker letztendlich in der 109. Minute mit dem Tor zum 4:3 in die Runde der letzten acht. Im Viertelfinale war es dann der SV Werder Bremen, der bezwungen werden musste.
Durch starke Schneefälle fand das Spiel unter erschwerten Bedingungen für beide Teams statt. Mit diesen Bodenverältnissen fand sich St. Pauli besser zu Recht. Das frühe 1:0 von Mazingu-Dinzey konnte Bremen zwar noch egalisieren, jedoch gelang es den Kiezkickern die Bremer so an die Wand zu spielen, dass Timo Schultz und Fabian Boll auf 3:1 erhöhen konnten. Nun stand man im Halbfinale gegen den FC Bayern München. Die Bayern gingen zwar mit 1:0 in Führung, aber dem FC St. Pauli gelang es, das Spiel an sich zu reißen und war die spielbestimmende Mannschaft. Zahlreiche hochkarätige Chancen wurden aber ausgelassen, sodass der FC Bayern kurz vor Schluss zwei Treffer erzielen und am Ende mit 3:0 gewinnen konnte. Trotz dieser Niederlage hatte der FC St. Pauli den Bayern alles abverlangt und dabei bewiesen, auch mit den "Großen" mithalten zu können.
2006/07 – Wir sind wieder da! Rückkehr in die 2.Liga
Der FC St. Pauli startet durchwachsen in die vierte Regionalligasaison. Nach 17 Spieltagen stand man nur auf Platz 12 und es drohte der Anschluss an die beiden Aufstiegsplätze verloren zu werden. Immerhin lieferte man sich im DFB Pokal eine weitere Pokalschlacht mit dem FC Bayern, die aber leider mit 1:2 nach Verlängerung verloren ging. In diesem Spiel hatte man die Münchner am Rande einer Niederlage jedoch ging die Partie in der Verlängerung durch ein unglückliches Eigentor verloren.
Ende November kam es dann zu einem Trainerwechsel um den erhofften Aufstieg doch noch zu erreichen. Für Andreas Bergmann übernahm Holger Stanislawski die Verantwortung für die Mannschaft. Und tatsächlich brachte dieser Trainerwechsel die Wende, mit vier Siegen innerhalb von 14 Tagen kämpfte sich der FC St. Pauli mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung an die Tabellenspitze der Regionalliga Nord. Ende April 2007 feierten rund 8.000 braun-weiße Fans in Bremen, nachdem das Nachholspiel bei der Reserve des SV Werder im Weserstadion mit 2:0 gewonnen wurde erstmals den Sprung an den ersten Tabellenplatz. Am drittletzten Spieltag in Erfurt schossen sich die Kiezkicker durch einen 3:0 Auswärtssieg in eine perfekte Ausgangslage für den Schlussspurt. Man hatte 6 Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz bei noch zwei ausstehenden Spielen. In den letzten beiden Partien reichte also ein einziger Punkt um die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt zu machen. Im letzten Heimspiel der Saison war es endlich so weit. Nach vier Jahren in der Regionalliga Nord machte der FC St. Pauli durch ein 2:2 gegen Dynamo Dresden den Aufstieg perfekt. Das Stadion feierte ausgelassen den Aufstieg, während beim Public Viewing auf dem Spielbudenplatz sich tausende Fans in den Armen lagen. Die Feierlichkeiten setzen sich auf dem Kiez und in der Schanze in der Nacht fort. Selbst am letzten Spieltag als man mit einem 1:1 die Aufstiegsträume des FC Magdeburg platzen ließ, zeigten sich die Kiezkicker als sportlich fair indem sie noch einmal alles auf dem Rasen gaben und das Spiel trotz Feierstrapazen nicht abschenkten. Nun war es endlich vollbracht, die lang ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga war perfekt.
Neben dem Aufstieg war noch ein anderes Thema beim FC St. Pauli von besonderer Bedeutung. Der Umbau des Stadions! Lange hatten Verein und Fans darauf gewartet, im Juli 2006 wurde offiziell bekanntgegeben, dass das Millerntorstadion umgebaut wird. Zuerst war die Südkurve dran. Im Dezember 2006 gab es eine große Südkurvenabrissparty auf der der Abriss/Umbau eingeläutet wurde. Im April 2007 bekam der Verein dann grünes Licht mit dem Bau beginnen zu können. Durch außerplanmäßige Bauverzögerungen konnte die neue Südtribüne jedoch leider nicht zum Saisonbeginn der folgenden Spielzeit fertig gestellt werden.
2007/08 - Souverän die Klasse gehalten / die Südtribüne steht
Mit sensationellen Transfers startete der FC St. Pauli in die neue Saison. Filip Trojan konnte vom VfL Bochum verpflichtet werden, Ralph Gunesch kehrte aus Mainz zurück und Alexander Ludwig wurde aus Dresden geholt. Das erste Saisonspiel war auch gleichzeitig der erste Härtetest. In der 1. Runde des DFB Pokals trafen die braun-weißen Kiezkicker auf die Werkself von Bayer 04 Leverkusen. In einem spannenden Pokalspiel nutzte der FC St. Pauli seine Chance und gewann das Spiel durch ein spätes Tor von Fabian Boll mit 1:0. Leider ging das Spiel in Runde zwei gegen die Reserve von Werder Bremen im Elfmeterschießen verloren. Als Aufsteiger spielte man in der Liga eine solide Saison. In der stärksten 2. Bundesliga aller Zeiten stand man nach 34 Spieltagen auf einem einstelligen Tabellenplatz, auf Platz 9 und hatte vier Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt konnte durch eine Siegesserie zwischen dem 25. und 31. Spieltag besiegelt werden. In diesen 7 Spielen konnte der FC St. Pauli fünfmal einen „Dreier“ einfahren. Am 31. Spieltag wurden die letzten benötigten drei Punkte durch ein 4:2 gegen Erzgebirge Aue geholt. Nach zweimaligem Rückstand kam der FC St. Pauli zurück und Carsten Rothenbach schoss das viel umjubelte Siegtor in der 72. Spielminute. Auch in Sachen Stadionbau tat sich in dieser Saison viel. Im November 2007 konnte das Richtfest der neuen Südtribüne gefeiert werden und die Zuschauer konnten es kaum erwarten die Tribüne zu entern. Am 13. Spieltag war es dann soweit, die Tribüne wurde zur Teilnutzung freigegeben und so konnten einige Fans im Stehplatzbereich das 2:0 gegen den FC Augsburg bewundern.
Das erste Tor in einem Spiel, wo die neue Südtribüne genutzt wurde, erzielte Ian Joy. Beim nächsten Heimspiel gegen Kaiserslautern konnte sogar fast der gesamte Stehplatzbereich von den braun-weißen Fans eingenommen werden. Einen Monat später im Dezember wurde das Clubheim mit viel Wehmut abgerissen, durch den Stadionumbau musste ein geliebter Treffpunkt des FC St. Pauli und seiner Fans „geopfert“ werden. Im Februar 2008 beim Spiel gegen Carl-Zeiss Jena wurde die Südtribüne zum ersten Mal fast komplett, auch im Sitzplatzbereich, genutzt. Im März 2008 wurde die kultige Anzeigetafel im Stadion durch den neuen Videowall ersetzt. Da man sich jedoch nicht ganz von der Anzeigetafel trennen wollte, wird diese nun auf den Videowall projiziert. Am Ende der Saison war die Südtribüne komplett nutzbar und auch die Geschäftsstelle und das Clubheim zogen in die Räumlichkeiten an der Budapester Straße ein. Wenig später sollte der Fanshop folgen.
2008/09 - Zuhause hui, auswärts pfui
Die zweite Saison nach dem Wiederaufstieg der Braun-Weißen in die 2. Bundesliga wurde am 18. Juli mit der offiziellen Einweihung der neuen Südtribüne eingeläutet. Mit einer großen Feier und einem 7:0-Sieg im Testspiel gegen die Nationalmannschaft von Kuba wurde die Tribüne seiner Bestimmung übergeben.
Nach dem Abgang von Charles Takyi konnten sich namhafte Neuzugänge wie Marius Ebbers, Mathias Hain und Rouwen Hennings dem heimischen Publikum präsentieren. Mit Dennis Daube stieß außerdem erneut ein Eigengewächs zum Profikader.
Am 8. August stand das erste Pflichtspiel der Saison an, das DFB-Pokalspiel beim FC Erzgebirge Aue. Nach 120 torlosen Minuten ging es ins Elfmeterschießen, bei dem Marius Ebbers zum tragischen Helden wurde. Nachdem Florian Bruns, Alexander Ludwig, Filip Trojan und Fabio Morena allesamt verwandelt hatten, scheiterte Ebbers an Stefan Flauder im Tor der Gastgeber. Wie im Vorjahr also das Pokal-Aus nach einem Elfmeterschießen.
In der Hinrunde der neuen Zweitligasaison galt das Motto "zuhause hui, auswärts pfui". Am Millerntor ungeschlagen, dafür nur ein Auswärtsdreier am zehnten Spieltag in Duisburg. An diesem Mittwochabend erzielten Florian Bruns und Neuzugang Rouwen Hennings die Treffer zum 2:1-Sieg beim MSV.
In den ersten drei Spielen der Rückrunde stand der Fußballgott nicht auf Seiten der Braun-Weißen, denn die Kiezkicker konnten nur gegen den VfL Osnabrück einen Punkt einsammeln. Erst am 21. Spieltag gab es einen Dreier gegen den 1. FC Kaiserslautern. In Überzahl konnten Alexander Ludwig und Morike Sako treffen und die Kiezkicker somit den ersten Sieg im neuen Jahr am Millerntor feiern.
Doch die Freude wurde prompt getrübt. Eine Woche später kassierten die Kiezkicker gleich fünf Gegentore beim TSV 1860 München und mit 1:5 die höchste Niederlage der Saison.
Davon motiviert besiegten die Braun-Weißen jedoch am folgenden Spieltag Hansa Rostock in einer nervenaufreibenden Partie mit 3:2 am Millerntor. Dieses Spiel hatte es in sich, da die Gäste bereits nach fünf Minuten mit 2:0 führten, aber die Kiezkicker legten alles in die Waagschale und drehten die Begegnung. Ebenfalls ausgesprochen erfolgreich verlief das nächste Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen. Mit 3:1 siegten die Braun-Weißen und sicherten sich drei weitere Zähler.
Die restliche Rückrunde klappte es bei den Kiezkickern mehr schlecht als recht. Mit nur drei Siegen und einem Unentschieden beendeten sie die Saison mit 48 Punkten im Tabellen-Mittelfeld auf dem achten Platz – und einem 2:0-Heimsieg über den FSV Frankfurt. Marius Ebbers und Alexander Ludwig teilten sich die Torjäger-Krone mit jeweils zehn Treffern. Die besten Zweikampf-Werte konnte Ralph Gunesch aufweisen, der bemerkenswerterweise mit nur einer Gelben Karte auskam.
Nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga konnten die Kiezkicker nach der Saison 2009/10 den verdienten Aufstieg ins Fußballoberhaus feiern. Doch erstmal nur für eine Saison. Die neue Saison begann mit einem Abschied. Die St. Paulianer mussten sich unter anderem schweren Herzens von Filip Trojan, Benjamin Weigelt und Alexander Ludwig trennen. Doch mit dem Abschied kam auch ein Anfang, denn vielversprechende Neuzugänge fanden ihren Weg ans Millerntor: Max Kruse, Matthias Lehmann, Deniz Naki, Charles Takyi und Markus Thorandt. Die Veränderungen im Kader der Kiezkicker verfehlten ihre Wirkung nicht, denn gerade zu Beginn der Hinrunde lief für den FC St. Pauli alles mehr als rund. Die ersten fünf Spiele ungeschlagen, 13 Punkte auf dem Tabellenkonto, dazu ein Torverhältnis von 16:5 und die Tabellenspitze.
Nach einem soliden 2:1 gegen Rot-Weiß Ahlen am ersten Spieltag vermasselten die Hamburger am zweiten Spieltag Alemannia Aachen die Premiere im neuen Tivoli gründlich: Mit 5:0 schossen die Kiezkicker die Alemannia ab. Besonders bitter für die Aachener - drei der fünf Tore schossen ausgerechnet die beiden ehemaligen Alemannen Florian Bruns und Marius Ebbers. Am 4. Spieltag zeigten sich die Stani-Schützlinge ebenfalls sehr treffsicher und verzauberten das Karlsruher Wildparkstadion. Neuzugang Matze Lehmann netzte doppelt ein, Geburtstagskind Rouwen Hennings und Ebbe trafen je ein Mal. Am Ende stand ein glanzvolles 4:0 bei den Badenern.
Erst Ende September wurde die Welle der Euphorie kurzfristig gedämpft. In den Spielen gegen den 1.FC Kaiserslautern und Arminia Bielefeld konnten keine Punkte mitgenommen werden. Die Niederlagen spiegelten sich auch gleich in der Tabelle wider, rutschten die St. Paulianer doch ruckzuck auf den vierten Platz ab. Dieses kurze Tief hielt auch im DFB-Pokal an. In der zweiten Runde war für die Braun-Weißen Endstation und Boller und Co. mussten sich dem Bundesligisten Werder Bremen mit 1:2 geschlagen geben.
Am achten Spieltag, als der Unglück bringende September endlich vorüber war, zeigten die Kiezkicker im Heimspiel gegen die Münchener Löwen ihren alt bekannten Kampfgeist, trotzten dem Starkregen und gewannen verdient mit 3:1. Der Bann war gebrochen. Bis zur Winterpause konnten die Boys in brown in neun Spielen 17 Punkte holen, drei davon beim 5:1 Sieg im Koblenzer Oberwerth Stadion, bei dem Max Kruse den Ball gleich doppelt im Netz zappeln ließ.
Zum Ende der Hinrunde 2009/10, gegen Fürth hatte es im letzten Heimspiel des Jahres ein 2:2 gegeben, reisten die Braun-Weißen nach Paderborn. Bei unglaublichen Minusgraden konnten die Kiezkicker die 1:2-Niederlage nicht verhindern. Als Tabellenzweiter verabschiedeten sich die Stani-Schützlinge mit 33 Punkten in den verdienten Winterurlaub.
Zum Rückrundenstart ging es zum Tabellenletzten RW Ahlen. Ein Sieg war Pflicht, um im Aufstiegs-Rennen weiterhin eine Rolle zu spielen. Doch in der ersten Halbzeit war das Schlusslicht die bessere Mannschaft und die Kiezkicker scheinbar noch mit den Gedanken in der Winterpause. In der zweiten Hälfte drehte sich der Wind und die erhoffte frische Brise kam auf. In der 77. traf Ebbers, in der 86. Sukuta-Paso, der bei seinem Debüt für die St. Paulianer nur 19 Sekunden nach seiner Einwechslung erfolgreich war. Was für eine Premiere für den ausgeliehenen Leverkusener!
Aus den ersten fünf Spielen der Rückrunde nahmen die Kiezkicker insgesamt 13 Punkte mit und blieben ungeschlagen. Vor dem 23. Spieltag hatten unsere Jungs sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Augsburg und lagen nur einen Punkt hinter der Spitze, dem 1. FC Kaiserslautern. Doch genau dieser zeigte den erfolgsverwöhnten Braun-Weißen an besagtem 23. Spieltag, wer die bessere Mannschaft auf dem Platz ist. Mit einem aussagekräftigen 3:0 entschieden die Roten Teufel das Spiel schmerzhaft deutlich für sich. Die 0:1-Heimniederlage gegen Bielefeld, das danach noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen wollte, war ebenfalls ziemlich ernüchternd, ebenso wie die Pleite bei den Münchner Löwen (1:2). Ausgeträumt? Nur noch Dritter und auch hier nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Ging den Kiezkickern die Puste aus?
Trainer Holger Stanislawski zumindest nicht: „Ab heute wird die Reset-Taste gedrückt. Wir fangen wieder bei null an. Wir haben 0:0 Tore und null Punkte", verkündete Stani der Mannschaft und den nicht weniger verdutzt guckenden Medienvertretern. 45 Minuten lang dauerte seine Ansprache an seine Spieler. Dass die Jungs zugehört und verstanden hatten, zeigte sich in den nächsten Wochen. Der Fußball wurde wieder attraktiver und vor allem erfolgreicher.
Mit drei Siegen (Oberhausen, Cottbus, Rostock) in Folge wurde das braun-weiße Selbstvertrauen gestärkt. Die Kiezkicker konnten auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken, allerdings noch immer mit sechs Zählern Abstand zum Tabellenersten Kaiserslautern und nur zwei Punkten Vorsprung auf die Augsburger. Zwar verloren die Kiezkicker eine Woche später in Düsseldorf (1:0), doch Verfolger Augsburg hatte auch so seine Probleme. So kam es am 30. Spieltag zum Showdown am Millerntor. Dieser ging zugunsten der Braun-Weißen aus, denn die St. Paulianer schickten Thurk und Co. mit einem furiosen 3:0 nach Hause. Matze Lehmann traf einmal, Ebbe netzte doppelt ein – ein klares Statement, wer im Millerntor die Fußballschuhe an hat.
Der Aufstieg war zum Greifen nah. Noch vier Spieltage, vier Punkte Vorsprung auf den Dritten, gar neun auf den Vierten. Aber unser FC St. Pauli wäre nicht unser FC St. Pauli, wenn die Spannung komplett fehlen würde. Nach dem wichtigen Sieg gegen Augsburg setzte es eine Woche später eine Niederlage bei Union Berlin, das in der 87. Minute durch Karim Benyamina erfolgreich war. Bei dem nervenschonenden 6:1 im darauffolgenden Heimspiel musste TuS Koblenz für die Wiedergutmachung herhalten. Charles Takyi traf doppelt, Deniz Naki, Matze Lehmann, Rouwen Hennings und Marius Ebbers je einmal. Damit war den St. Paulianern zumindest der Relegationsplatz sicher, während die Kaiserslauterner schon mal den Aufstieg in die 1. Bundesliga feiern duften, trotz 0:1-Niederlage gegen Hansa Rostock.
Das vorletzte Spiel der Saison fand bei Greuther Fürth statt, die zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen. Doch nach der Pause drehte St. Pauli das Spiel. Der Ausgleich durch Deniz Naki sorgte für ein kämpferisches „Yes!“. Die Führung durch Ebbers 14 Minuten später für ein ausgeflipptes „Jaaaaa!“. Als Charles Takyi in der 73. auf 3:1 erhöhte, flossen die ersten Freudentränen. Rouwen Hennings 4:1 bekamen die meisten schon gar nicht mehr mit... Was danach passierte, wurde für die Ewigkeit in den Gedächtnissen eingebrannt: Der FC St. Pauli war wieder in der 1. Bundesliga. Bei der Aufstiegsfeier auf dem Spielbudenplatz feierte die Mannschaft gemeinsam mit den Fans den Abschluss einer glorreichen Saison.

Auf dem Transfermarkt war zu Beginn der neuen Saison einiges los. Patrick Borger und Morike Sako verließen den Verein und Thomas „Meggi“ Meggle beendete seine Karriere als aktiver Fußballer. Dafür verstärkten Fin Bartels, Moritz Volz, Gerald Asamoah, Carlos Zambrano und die geliehenen Spieler Bastian Oczipka und Keeper Thomas Kessler von nun an das Team der Kiezkicker.
Der Hinrundenstart in der 1. Bundesliga hätte für die Braun-Weißen gar nicht besser laufen können. Nach einem 0:1 Rückstand im Breisgau beim SC Freiburg, konnten die Kiezkicker das Spiel drehen – mit einem wahren Tor-Feuerwerk und drei Treffern in sieben Minuten. In der 83. netzte Fabian Boll ein, darauf folgte Richard Sukuta-Pasu in der 89. und in der 90. Minute versenkt Neuzugang Fin Bartels das Leder im Freiburger Kasten. Auswärtssieg und noch dazu der zweite Tabellenplatz.
Leider war die anfängliche Freude nur von kurzer Dauer. Am zweiten Spieltag ließen die Kiezkicker drei Punkte gegen die TSG Hoffenheim liegen (0:1), am dritten Spieltag verloren sie gegen den 1. FC Köln, ebenfalls mit 0:1, und schon fand man sich auf dem 13. Tabellenplatz wieder.
Einen ersten Lichtblick konnten die Braun-Weißen am 19. September erhaschen: das erste Spiel gegen den Lokalrivalen. Nach dem Führungstreffer in der 77. Minute durch Fabian Boll lagen sich die Fans am Millerntor bereits siegessicher in den Armen. Aber zwei Minuten vor dem Ende gelang dem HSV der Ausgleich durch Mladen Petric. Schade – aber die elf Minuten Führung waren es wert.
Mit einem Sieg am fünften Spieltag bei Borussia Mönchengladbach (2:1) konnten die Kiezkicker bis auf den neunten Tabellenplatz klettern, nur einen Rang hinter den Bayern. Von der 1:3-Pleite bei Borussia Dortmund am darauf folgenden Spieltag ließen sich die Stani-Schützlinge aber nicht beeindrucken, schließlich wollte man den Bayern ja weiterhin auf den Fersen bleiben. Das klappte auch ganz gut. Am siebten Spieltag traf Marius Ebbers zum Sieg für die Braun-Weißen in Hannover, im folgenden Heimspiel machten Gerald Asamoah, Marius Ebbers und Florian Bruns den Dreier mit einem 3:2 am Millerntor gegen die Nürnberger klar. Damit standen die Kiezkicker mit 13 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter dem Lokalrivalen.
Nach diesem großartigen Start ging es für die Braun-Weißen jedoch nicht mehr so rosig weiter. Bis zur Winterpause konnten sie nur noch ein Mal, beim Heimspiel gegen Kaiserslautern, als Sieger vom Platz gehen (1:0). Die Hinrunde beendeten sie auf dem 15. Tabellenplatz mit 17 Punkten auf dem Konto aber immerhin noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.
Mit zwei Unentschieden gegen Freiburg (2:2) und Hoffenheim (2:2) starteten die Kiezkicker schließlich ins neue Jahr. Als Aufwärmübung sozusagen, denn danach gab die Mannschaft richtig Gas: drei Siege in Folge, von dem einer sogar legendär wurde. Am 20. Spieltag besiegte die Stanislawski-Elf zuhause den 1. FC Köln mit 3:0. Charles Takyi traf doppelt, Flo Bruns ein Mal. Eine Woche später netzten Max Kruse, Gerald Asamoah und Matthias Lehman ein und besiegelten den 3:1-Erfolg gegen Gladbach.
Und dann kam er, der 16. Februar, an dem der FC St. Pauli nach 33 Jahren Geschichte schrieb. Nach torloser erster Halbzeit in der Imtech-Arena ereignete sich in der 59. Minute Historisches im Stadtderby.
Max Kruse legte sich an der Eckfahne die Kugel bereit und zirkelte das Leder in Richtung Fabian Boll, der sich schon im Hinspiel als Torschütze auszeichnen konnte. Boller leitete den Ball fast schon akrobatisch mit dem Absatz in Richtung zweiten Pfosten weiter, wo ein anderer Kiezkicker nur noch einköpfen musste. Das Goldköpfchen hieß: Gerald Asamoah.
Der anschließende braun-weiße Jubel war einfach unglaublich. Die Freude nach dem Schlusspfiff kannte sowohl im Gästeblock, als auch bei den ca. 10.000 Fans beim Public Viewing im Millerntor-Stadion, aber auch in allen Kneipen und Wohnzimmern, in denen St. Pauli-Fans ihrem Team die Daumen drückten, keine Grenzen!
Mit diesen drei Siegen kam auch der Sprung in der Tabelle. Die Boys in brown hatten sich aus dem Tabellenkeller wieder hoch auf den elften Platz gekämpft.
Doch nach diesem denkwürdigen Ereignis wollte leider so gar nichts mehr klappen. Bis zum Saisonende konnten die Kiezkicker nur noch einen einzigen Punkt in der Partie gegen den VfL Wolfsburg holen (2:2). Insgesamt bekamen die Braun-Weißen in den letzten zwölf Spielen 33 Gegentore (allein acht davon in der Begegnung mit den Bayern am vorletzten Spieltag) und konnten das Leder gleichzeitig nur acht Mal selbst im Netz der Kontrahenten zappeln lassen. Eine traurige Bilanz.
Noch trauriger wurde es zum Ende der Saison. Unter anderem, weil der FC St. Pauli schlussendlich mit 29 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz landete. Aber vor allem, weil Chef-Coach Holger Stanislawski nach fast 20 Jahren im Verein seinen Wechsel zur TSG Hoffenheim bekannt gab. Als Aktiver erzielte der gebürtige Hamburger für die Braun-Weißen 18 Tore in 260 Spielen, arbeitete später in verschiedenen Positionen beim Club und übernahm im November 2006 als Trainer die Profimannschaft. Mit seinem Abschied ging beim FC St. Pauli eine Ära zu Ende.
Aber auf jeden Abschied folgt auch ein Neubeginn. Anfang Mai wurde André Schubert, der bis dato Trainer beim SC Paderborn war, als neuer Coach am Millerntor begrüßt. Gemeinsam mit den Kiezkickern hat er in der folgenden Saison direkt wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Nach dem Abstieg in die 2. Liga verließen nicht nur Holger Stanislawski, André Trulsen und KP Nemeth den FC St. Pauli sondern auch einige lieb gewonnene Spieler. Florian Lechner wechselte zum Karlsruher SC, Marcel Eger wagte den Weg zum FC Brentford nach England und Matthias Lehmann packte seinen Koffer in Richtung Frankfurt. Auch von den geliehenen Kickern Bastian Oczipka und Thomas Kessler musste sich das Team schweren Herzens verabschieden. Timo Schulz wechselte zur U23 um sich dort unter anderem der neuen Herausforderung als Co-Trainer zu widmen. Torwart Mathias Hain beendete seine Karriere als Aktiver und kümmerte sich von nun an um das Training der Millerntor-Keeper, unter anderem um Neuzugang Philipp Tschauner. Außerdem kamen Sebastian Schachten, Mahir Saglik und Kevin Schindler als weitere Unterstützung zur Mannschaft dazu, ebenso die ausgeliehenen Patrick Funk, Lasse Sobiech und Petar Slišković - und natürlich der neue Chef-Coach André Schubert.
Das erste Heimspiel der neuen Saison fand auswärts im Lübecker Stadion an der Lohmühle statt. Gegen Ingolstadt. Was hier komisch klingt, hatte jedoch einen äußerst unschönen Hintergrund, eine Altlast aus der letzten Saison. Nachdem ein Zuschauer bei der Erstliga-Partie gegen Schalke 04 einen Bierbecher auf das Spielfeld geworfen hatte und damit unglücklicherweise einen der Linienrichter traf, hatte der DFB für das erste Heimspiel eine Platzsperre für das Millerntor-Stadion verhängt. Die Kiezkicker mussten für den Saisonauftakt also ihre Fußballschuhe einpacken und sich gemeinsam mit 10.000 Fans auf den Weg ins 60 Kilometer entfernte Lübeck machen. Dank Fabian Boll wurde dieses Auswärts-Heimspiel jedoch zu einem stilechten Millerntor-Erlebnis, denn der Sechser netzte an der Lohmühle doppelt ein und führte sein Team zum verdienten 2:0 Sieg gegen die Ingolstädter.
Und genau so fulminant ging es weiter. Bis zum fünften Spieltag blieben die Schützlinge von André Schubert ungeschlagen und befanden sich mit 13 Punkten an der Tabellenspitze. Eintracht Braunschweig versetzte den Kiezkickern am sechsten Spieltag allerdings einen ersten Dämpfer. Nach dem Treffer von Dennis Kruppke in der 65. Minute verloren die Braun-Weißen auswärts 0:1. Die erste Niederlage der Saison.
Doch dafür gaben die Kiezkicker an den folgenden Spieltagen wieder richtig Gas. Die Münchner Löwen wurden nach einem 0:2 Rückstand in einer furiosen Aufholjagd mit 4:2 bezwungen und der KSC mit 2:0 im Wildpark-Stadion in seine Schranken gewiesen. Und auch Energie Cottbus Elf konnte am zehnten Spieltag mit 4:1 besiegt werden. Gegen Erzgebirge Aue (2:3) konnten zwar keine Punke eingefahren werden, doch davon ließ man sich am Millerntor nicht bremsen. Nach dem zehnten Spieltag konnten sich Max Kruse und Marius Ebbers bereits über sechs bzw. fünf Tore freuen. Eine gute Bilanz für die Kiezkicker.
Bis zum Ende der Hinrunde fuhren die Schubert-Schützlinge fünf weitere Siege ein, gegen Paderborn (1:1) und Greuther Fürth (2:2) mussten sie sich mit einem Unentschieden zufrieden geben. Nur ein Mal gingen sie als Verlierer vom Platz, bei der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am elften Spieltag (1:3).
Mit 36 Punkten und dem vierten Tabellenplatz starteten die Braun-Weißen in die Rückrunde. Beim ersten Spiel gegen den FC Ingolstadt mussten die Kiezkicker jedoch eine herbe Niederlage hinnehmen. Mit 0:1 unterlagen sie der Truppe aus dem Audi Sportpark nach dem Last-Minute-Treffer von Ahmed Akaichi in der 89 Minute.
Diesen Misserfolg machte die Schubert-Truppe am letzten Spieltag vor der Winterpause jedoch mit einem 2:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt wieder wett. Fabio Morena aus kurzer Distanz nach einem Eckball und Max Kruse nach einem tollen Konter trafen gegen den Tabellenzweiten zum nicht unverdienten Sieg. Doch die Freude nach dem Spiel blieb gedämpft, denn Keeper Philipp Tschauner verletzte sich kurz vor Schluss an der Schulter. Die Diagnose:
Schultereckgelenksprengung und doppelter Bänderriss. Ein weiterer Wehrmutstropfen: Frankfurts Pirmin Schwegler wurde in der zweiten Halbzeit von einer Kassenrolle getroffen. Zum Glück konnte der Frankfurter unverletzt weiter machen, doch hatte dieser Vorfall für den Club ein Nachspiel beim DFB-Sportgericht.
Nach der Wintervorbereitung mussten sich die Kiezkicker von Ralf „Ralle“ Gunesch trennen. Der Verteidiger hatte sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, zum FC Ingolstadt zu wechseln. Dafür kam jedoch Keeper Philipp Heerwagen als Leihgabe vom VfL Bochum zur Verstärkung der Braun-Weißen, während Benedikt Pliquett von nun an bis zur Genesung von Philipp Tschauner die neue Nummer eins im Tor der Braun-Weißen wurde.
Nach einer Niederlage auf dem Aachener Tivoli (1:2) konnten die Kiezkicker im neuen Jahr mehrere Siege einfahren. Beim ersten Heimspiel gegen den VfL Bochum traf Sebastian Schachten doppelt und führte die Braun-Weißen zum verdienten 2:1 Sieg.
Auch gegen die Duisburger Zebras (1:0) und den Karlsruher SC (1:0) konnte die Schubert Elf dreifach punkten. Während es gegen Eintracht Braunschweig (0:0) und beim TSV 1860 München (1:1) zwei Remis für die Kiezkicker gab, mussten Boller und Co. bei Erzgebirge Aue in letzter Minute eine bittere 1:2 Niederlage hinnehmen.
Obwohl die Braun-Weißen nach dem etwas schwerfälligen Start ins neue Jahr eigentlich den Turbo einlegen wollten, reichte es in den kommenden drei Partien nur für je einen Punkt auf dem Tabellenkonto. Gegen Energie Cottbus und Fortuna Düsseldorf klingelte der Kasten gar nicht, im Stadion am Bornheimer Hang klingelte es dann gewaltig – allerdings zunächst drei Mal in Folge für den FSV Frankfurt in nur 20 Minuten. Mit viel Einsatz, Kampfgeist und einer beeindruckenden Aufholjagd konnten Marius Ebbers (23.), Max Kruse (41. FE) und Fin Bartels (46.) das Blatt jedoch zum Guten wenden und am Ende noch einen Punkt für die Kiezkicker retten.
Mit diesem nervenaufreibenden Spiel war der Kampf für die Schubert-Schützlinge jedoch noch lange nicht beendet. Das beste Beispiel lieferte dafür die Partie gegen Union Berlin am 30. Spieltag. Nachdem die Gäste durch Markus Karl in Führung gegangen waren (32.) und Max Kruse nach dem Seitenwechsel ausgleichen konnte (59.), wurde es in der Schlussphase noch einmal dramatisch. In der 81. Minute drehte St. Pauli das Spiel vermeintlich durch einen Treffer von Marius Ebbers, doch der Stürmer gab trotz des dadurch drohenden Rückschlages im Kampf um den dritten Tabellenplatz zu, den Ball mit der Hand gespielt zu haben. Der Fußballgott belohnte Ebbes Fairplay jedoch umgehend, denn Bartels traf in der Nachspielzeit zum Sieg für Braun-Weiß.
Im Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer aus Fürth war das Glück jedoch nicht mehr auf der Seite der Schubert Elf. Nach den Treffern von Heinrich Schmidtgal (6.) und Ex-St. Paulianer Gerald Asamoah (65.) mussten sich die Mannschaft mit 1:2 geschlagen geben, während die Mittelfranken an diesem Spieltag den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die 1. Bundesliga feiern durften. Die Hoffnung doch noch aufzusteigen war damit aber noch lange nicht gestorben.
Das erste der drei verbleibenden Spiele konnten die Braun-Weißen mit einem 3:0-Sieg gegen Hansa Rostock am Millerntor gebührend feiern, wenn auch ohne Gäste-Fans, denn die Polizei hatte den Rostockern den Stadionbesuch aus Sicherheitsgründen untersagt. Ebbers konnte mit einem Doppelschlag glänzen (12. + 49.), Fin Bartels machte den Dreier in der 79. Minute perfekt. Doch nicht nur Schuberts Truppe hatte Grund zum Jubeln. Der Tabellenzweite Eintracht Frankfurt sicherte sich an diesem Wochenende den Aufstieg ins Oberhaus - somit begann nun der Kampf um die Relegation, ausgetragen vom FC St. Pauli, dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf.
Nachdem sich die Mannschaft im letzten Auswärtsspiel der Saison gegen Dynamo Dresden 0:1 geschlagen geben musste, legten die St. Paulianer am 34. Spieltag, dem letzten Spieltag mit der alten Gegengerade, noch einmal alles in die Waagschale. Während die Düsseldorfer zeitgleich gegen den MSV Duisburg um den dritten Platz spielten, traten am Millerntor die direkten Kontrahenten aus Paderborn in den Ring. Mit 61 Punkten hatten die Fortunen und die Paderborner im Rennen die Nase vorn, denn die Braun-Weißen starteten mit „nur“ 59 Zählern in die Partie.
Das letzte Spiel der Saison wurde dann mehr als emotional, anders kann man es wohl nicht beschreiben. Die Kiezkicker zeigten Fußball der Extraklasse und bewiesen 90 Minuten lang Leidenschaft und Kampfgeist, die sich auszahlten. Zur Halbzeit führten sie bereits 2:0 nach den Treffern von Lasse Sobiech (30.) und Max Kruse (36.). In der zweiten Hälfte legten sie dann noch eine Schippe drauf: Florian Bruns (60.), Moritz Volz (65.) und Deniz Naki (90.) sorgten für ein klares 5:0. Der Jubel war groß, die Tribünen bebten, doch wie so oft im Leben, fehlte das Quäntchen Glück am Ende doch – denn Düsseldorf erzielte ein Remis gegen die Duisburger Zebras. Das Erreichen des Relegationsplatzes scheiterte also letztendlich an einem schlechteren Torverhältnis und der FC St. Pauli beendete die Saison auf Rang vier der Tabelle.

Nach Platz vier im Vorjahr ging es in der Sommerpause wieder rund auf dem Transfermarkt: Viele Spieler verließen den FC St. Pauli, darunter Max Kruse, Fabio Morena, Carsten Rothenbach und Moritz Volz. Auch Deniz Naki verließ unsere Kiezkicker in Richtung Paderborn und Rouven Hennings unterschrieb beim Karlsruher SC. Die Ausleihfristen von Petar Sliskovic, Lasse Sobiech und Philipp Heerwagen liefen ebenfalls ab, und so mussten auch sie die Hansestadt verlassen um zu ihren Vereinen zurück zu kehren. Auf der anderen Seite wurde die Mannschaft natürlich auch verstärkt. Die Defensive konnte durch Florian Mohr und Sören Gonther vom SC Paderborn und den von Hannover 96 geliehenen Christopher Avevor unterstützt werden. Für eine bessere Besetzung des Mittelfelds sorgten Joseph-Claude Gyau (TSG 1899 Hoffenheim), Akaki Gogia (VfL Wolfsburg), Christopher Buchtmann (1. FC Köln) und Florian Kringe (Borussia Dortmund). Als neue Akteure im Sturm wurden Daniel Ginczek (Borussia Dortmund) und Lennart Thy (SV Werder Bremen) verpflichtet. Außerdem schafften die Nachwuchstalente Marcel Andrijanic und Florian Kirschke den Sprung in die erste Mannschaft.
Nach einem torlosen Auftakt in Aue im Erzgebirge, konnten die Kiezkicker auch im ersten Heimspiel gegen Ingolstadt nur einen Zähler für ihr Punktekonto gewinnen (1:1). Die Mannschaft konnte in beiden Spielen zwar solide auftreten, jedoch fehlte der letzte Biss zum Sieg. Im ersten Pokalspiel gegen den Oberligisten Offenburger FV ließ man keine Fehler zu und gewann die Partie souverän mit 3:0. Am darauffolgenden Wochenende musste die Schubert-Elf nach Cottbus reisen. Dort mussten sie, da man nicht so recht ins Spiel fand, eine 0:2-Niederlage einstecken. Zum nächsten Spieltag kam der bis dahin ungeschlagene Aufsteiger SV Sandhausen zu Besuch ans Millerntor. Nach der, durch die Kiezkicker dominierten, ersten Halbzeit, erzielten Fin Bartels und Marius Ebbers in der 71. und 76. Minute zwei wichtige Treffer. Die Sandhausener konnten zwar in der 83. Minute nachlegen, aber die drei Punkte blieben im Norden.
Nicht ganz so unspektakulär wie das Endergebnis verlauten lässt, verlief das Spiel in Köln. Die zweite Halbzeit war ebenso geladen mit Chancen wie die erste, doch die Kiezkicker scheiterten immer wieder im Abschluss, so dass das Duell mit der Elf von Ex-St. Pauli-Coach Holger Stanislawski torlos endete. Auch in der Partie gegen den FSV Frankfurt konnte sich unsere Elf nicht durchsetzten und kassierte früh den ersten Gegentreffer. Ginczek konnte in der 58. Minute ausgleichen, doch Frankfurt legte noch einen Treffer nach und behielt so die drei Punkte. Ein ähnliches Szenario erlebten die Fans auch gegen Aalen. Die Mannschaft zeigte Leidenschaft und Kampfgeist, doch viele Fehler führten letztendlich zur 0:1-Niederlage. Als Konsequenz wurde André Schubert am Tag nach dem Spiel in seiner Funktion als Trainer entlassen und seine Co-Trainer Thomas Meggle, Timo Schultz und Mathias Hain übernahmen gegen Jahn Regensburg die Führung der St. Paulianer.
In der kurzen Zeit gelang es dem neuen Trainerteam jedoch nicht, genug Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen, um die Spielweise und Leistung zu verändern. Gegen Union Berlin zeigten die Braun-Weißen vor dem Heimpublikum jedoch vollen Einsatz und gingen nach Startschwierigkeiten sogar kurzzeitig in Führung. Am Ende verkündete die Anzeigentafel den 2:2-Endstand, eine Leistung mit der man durchaus zufrieden sein konnte.
Nach einer Woche Testspielpause änderte sich das Blatt für die Braun-Weißen. Unter der Leitung des neuen Trainers Michael Frontzeck konnten die Kiezkicker einen Punkt entführen und zuhause gegen Dresden sogar drei Punkte mitnehmen, obwohl die Partie kurzzeitig für die Gäste entschieden schien, denn die Frontzeck-Elf lag zunächst 0:2 zurück, konnte die Partie jedoch mit jeder Menge Kampfgeist auf 3:2 drehen. Das zweite Pokalspiel gegen den Erstligisten VfB Stuttgart konnten die Schützlinge von Michael Frontzek allerdings nicht für sich entscheiden. Drei Tore in der ersten Halbzeit sorgten für den 0:3-Endstand und somit für das Pokalaus der braun-weißen Jungs.
Hochverdient erspielten sich die Jungs vom Kiez den Sieg gegen 1860, der erste und einzige Auswärtssieg der Hinrunde. Etwas unglücklich verspielte die Elf den Sieg gegen den VfL aus Bochum, durch ein mit dem Rücken verlängerten Ball (1:1). Ebenso unglücklich verlor man das, erst in der 85. Minute entschiedene, Spiel gegen Hertha BSC Berlin (0:1).
Ein wahres Topspiel lieferte die Elf vom Millerntor den Fans am 15. Spieltag zuhause gegen den MSV Duisburg. Beide Mannschaften spielten in der ersten Hälfte sehr stark auf und nach dem 1:0-Führungstreffer durch Ginczek nach knapp 20 Minuten gelang es den Zebras aus Duisburg noch knapp vor der Pause auszugleichen. In der zweiten Halbzeit brachen die Duisburger jedoch regelrecht ein und Fin Bartels lies den Gästen von der Wedau mit seinen zwei Toren praktisch keine Chance. Saglik erhöhte kurz vor Schluss auf 4:1.
Der im letzten Spiel bejubelte Fin Bartels sah am nächsten Wochenende gegen Braunschweig schon nach 22 Minuten die rote Karte. Der Tabellenführer war in der 17. Minute in Führung gegangen, die Kiezkicker gaben sich jedoch noch nicht geschlagen. Das Spiel wurde zu einem offenen Schlagabtausch und fast hätte man den Ausgleich geschafft, doch die Begegnung endete letztendlich mit einem 1:0-Sieg für den Tabellenführer.
Im lange Zeit umstrittenen Spiel gegen Kaiserslautern hatte die Mannschaft das Glück, das im letzten Spiel fehlte und entschied das Spiel mit dem 1:0 in der 67 Minute für sich. Am zweiten Advent mussten zahlreiche Helfer das Spiel vom Schnee befreien, der in den Tagen zuvor gefallen war. Mit diesen winterlichen Bedingungen und den eisigen Temperaturen am Millerntor kamen die Gäste aus dem Erzgebirge deutlich besser klar und konnten die Partie nach einer torlosen ersten Halbzeit noch mit einem furiosen 3:0 für sich entscheiden.
Zum letzten Spiel vor der Winterpause mussten unsere Jungs nach Ingolstadt reisen. Im neuen Zuhause von Ex-Kiezkicker Ralph Gunesch konnten sie allerdings nur einen Punkt mitnehmen, da ein reguläres Tor in der 13. Minute für die Frontzek-Elf nicht gegeben wurde. Somit überwinterte der FC St. Pauli auf dem 13. Tabellenplatz und startete im ersten Spiel des neuen Jahres mit Vollgas gegen die Gäste aus Cottbus.
Vor mehr als 26.000 Zuschauer endete die Partie gegen die Lausitzer torlos. Dennoch gab es etwas zu feiern: Erstmals seit dem Abriss der Gegengeraden im Mai 2012 konnte die neue Tribüne vollständig genutzt und somit eingeweiht werden.
Die Elf von Michael Frontzeck reiste am 21. Spieltag zum SV Sandhausen. Nach drei sieglosen Partien wollten die Kiezkicker wieder einen Dreier bejubeln, doch es sollte ganz anders kommen. Bereits zur Pause stand es 0:3, der SVS konnte gar den vierten Treffer erzielen. Florian Kringes verwandelter Foulelfmeter zum 1:4 änderte nichts mehr an der Niederlage.
Ein Wiedersehen mit Stani und Truller erwartete unseren FC St. Pauli dann eine Woche später, als der 1. FC Köln ans Millerntor reiste. Wieder ging die Frontzeck-Elf leer aus, weil Kölns Clemens in der 2. Minute den einzigen Treffer des Tages erzielte und für erneut lange Gesichter auf Seiten der Braun-Weißen. Drei Punkte betrug der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 nur noch. Bitter zudem: Markus Thorandt und Florian Mohr wurden mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz geschickt und fehlten somit im nächsten Heimspiel gegen das Überraschungsteam FSV Frankfurt.
Auch ohne das Duo sollte unseren Kiezkickern eine der besten Saisonleistungen gelingen. Mit 3:0 wurde der FSV besiegt, gleich dreimal traf Angreifer Daniel Ginczek zum hochverdienten Sieg. Von Platz 14 ging es rauf auf 12, der Abstand auf Dresden (16., 21 Punkte) wuchs auf fünf Zähler. Durch ersten Sieg seit Anfang Dezember sammelte die Frontzeck-Elf wichtiges Selbstvertrauen.
Nach dem 1:0 beim VfR Aalen - Ginczek bewies in der Schlussminute Nervenstärke und verwandelte einen an ihn verursachten Foulelfmeter - konnte der Abstand auf Dynamo beibehalten werden. Dramatisch, aber erfolgreich verlief dann das dritte Freitagabend-Heimspiel in Folge gegen den SSV Jahn Regensburg. Dank des Last-Minute-Treffers von Florian Bruns siegte unser FC St. Pauli mit 3:2. Zuvor trafen Gogia (18.) und Ginczek (66.) sowie Koke (23.) und Kamavuaka (89.). Dank des dritten Dreiers in Serie konnte der Vorsprung auf Dresden auf acht Zähler vergrößert werden.
Mit viel Selbstvertrauen reisten die Kiezkicker am 26. Spieltag zu Union Berlin und erstmals mussten sie wieder eine Niederlage einstecken. Terodde (20.), Ebbers (37.) und Mattuschka (42.) trafen vor der Pause, Schachten (76.), Nemec (81.) und erneut Terodde (84.) im zweiten Durchgang. Nach Schachtens Ausgleich verpasste es die Braun-Weißen, etwas Zählbares mit nach Hamburg zu nehmen.
Wenngleich es im folgenden Heimspiel gegen Paderborn nur zu einem Zähler reichen sollte, war es ein gefühlter Sieg - mit einem Helden im Torwartdress. Nachdem Ebbers das 1:0 erzielt hatte, drehten Yilmaz (56.) und ausgerechnet Saglik (84.), der in der Winterpause zum SCP wechselte, die Partie. In der 90. Minute dann noch mal Eckball für St. Pauli: Keeper Philipp Tschauner rennt mit nach vorne, stieg zum Kopfball hoch und verwertete die Ecke zum viel umjubelten 2:2 in die Maschen. Dank des Punktgewinns hatten die Braun-Weißen sieben Zähler Vorsprung auf Dresden, dem nächsten Gegner.
Und die kommende Partie war nichts für schwache Nerven. Nach torloser erster Halbzeit sorgten Mohr (50.) und Ginczek (53.) per Doppelschlag für eine scheinbar beruhigende Führung. Doch wie im Hinspiel (3:2 für St. Pauli nach 0:2-Rückstand) gab die Heimelf nicht auf und behielt nach Treffern von Trojan (62.), Losilla (66.) und Schuppan (77.) mit 3:2 die Oberhand. Eine extrem bittere Niederlage für den FC St. Pauli, der mit einem Sieg den Klassenerhalt praktisch schon in der Tasche gehabt hätte. Anstatt sieben wären es zehn Punkte auf Bochum gewesen.
Im drittletzten Heimspiel der Saison gegen 1860 München wurde am Ende aber wieder gejubelt. Die Niederlage gegen Dynamo verdauten Kringe und Co. sehr gut, die Löwen wurden mit 3:1 bezwungen. Ginczek und Doppeltorschütze Bartels trafen für braun-weiß, Münchens Friend konnte zwischenzeitlich auf 2:1 verkürzen.
Am 30. Spieltag gastierten die Frontzeck-Schützlinge dann beim VfL Bochum. Mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wollte man den Klassenerhalt perfekt machen. Da zahlreiche Chancen ungenutzt blieben und der VfL einfach effizienter in der Verwertung seiner Möglichkeiten war, unter man am Ende 0:3. Da Dresden zeitgleich gegen Cottbus gewann, betrug der Vorsprung bei noch vier ausstehenden Partien nur noch fünf Zähler.
Eine erneute Niederlage der ganz bitteren Art mussten die Braun-Weißen anschließend gegen Hertha BSC, das bereits als Aufsteiger in die 1. Bundesliga feststand, einstecken. Bis 120 Sekunden vor Schluss führte man 2:1, nachdem Allagui für die Gäste (23.) sowie Thy (66.) und Ginczek (85., FE) für St. Pauli trafen. Die späten Tore von Ronny (88.) und Wagner (90.) sorgten für einen nicht mehr erwarteten Auswärtssieg der Berliner.
Nach vielen Gegentoren in den zuvor ausgetragenen Partie die gute Nachricht vorweg: Beim MSV Duisburg blieb Tschaunis Kasten endlich wieder sauber, die Defensive stand tadellos. Da vorne die Kugel aber nicht ins Tor wollte, endete das drittletzte Spiel der Saison torlos. Der Vorsprung auf Platz 16 (Dresden) nun: drei Zähler.
Der endgültige Befreiungsschlag erfolgte dann im letzten Heimspiel der Saison gegen Braunschweig. Gegen die Eintracht wurde beim 5:1 (Tore: 1:0 und 2:0 Ginczek, 3:0 Bartels, 4:0 Bruns, 5:0 Ebbers, 5:1 G. Korte) der höchste Saisonsieg herausgeschossen und am Ende der Klassenerhalt perfekt gemacht. Besonders erfreulich: In ihrem letzten Heimspiel für den FC St. Pauli trafen Bruns (sieben Jahre braun-weiß) und Ebbers (fünf Jahre). You'll never walk alone an dieser Stelle noch mal!
Zum Abschluss konnten die Kiezkicker völlig befreit auf dem Betzenberg aufspielen. Gegen den Tabellendritten Kaiserslautern gelang der zweite Sieg in Folge - Daube und Ginczek (Saisontor Nummer 18) hießen die Torschützen - Baumjohanns Anschlusstreffer sollte am Auswärtssieg nichts mehr ändern. Durch den dritten Auswärtssieg der Saison beendete der FC St. Pauli die Spielzeit 2012/13 mit 43 Zählern (11 Siege, 10 Remis, 13 Niederlagen) auf dem 10. Platz.

Mit dem positiven Gefühl, den Klassenerhalt kurz vor Saisonende perfekt gemacht zu haben, starteten unsere Kiezkicker in die neue Spielzeit. Neben den beiden Eigengewächsen Okan Kurt und Andrej Startsev wurden nicht weniger als neun neue Spieler ans Millerntor geholt. John Verhoek, Christopher Nöthe, Bernd Nehrig, Marc Rzatkowski, Philipp Ziereis, Michael Gregoritsch, Sebastian Maier, Marcel Halstenberg und Philipp Heerwagen sollten dafür sorgen, dass es in der Tabelle wieder bergauf geht.
Dem 1:0-Auftaktsieg gegen 1860 München folgte ein torloses Remis beim Karlsruher SC. Beim Drittligisten Preußen Münster folgte dann, wie in den Vorjahren auch schon, das frühe Aus im DFB-Pokal – 0:1 hieß es am Ende für die Preußen. Durchwachsen ging es für die Elf von Coach Michael Frontzeck auch weiter: Es folgten ein 0:1 gegen Arminia Bielefeld sowie ein 2:2 beim VfL Bochum. Beim 2:1 gegen Dynamo Dresden konnte dann endlich wieder gefeiert werden. Matchwinner hier: Maier, der kurz vor dem Abpfiff mit seinem ersten Ballkontakt einen Freistoß zum Siegtreffer in die Maschen beförderte. Zuvor stand Keeper Philipp Tschauner im Mittelpunkte, er parierte einen Elfmeter von Dynamo-Captain Christian Fiel.
Nach der 2:3-Pleite bei bei Union Berlin holten die Braun-Weißen sieben von neun möglichen Zählern: 2:1 gegen den FSV Frankfurt, 1:1 Fortuna Düsseldorf und 2:1 gegen den FC Ingolstadt. Bis zum Ende der Hinrunde fuhren die Kiezkicker vier weitere Siege gegen Fürth (4:2), Cottbus (3:0, hier feierte Roland Vrabec sein Debüt als Cheftrainer, nachdem Michael Frontzeck beurlaubt worden war), Aalen (1:0) und Aue (2:0) ein. Die Partien gegen den späteren Aufsteiger Paderborn (1:2) und gegen die beiden Aufstiegskandidaten Kaiserslautern (1:4) und Köln (0:3) gingen jedoch verloren. Zum Ende der Hinrunde belegten die Braun-Weißen mit 8 Siegen, 4 Remis und 5 Niederlagen Platz vier, punktgleich hinter den Roten Teufeln.
Vor Weihnachten gelang zunächst ein 2:0-Erfolg bei den Münchner Löwen, ehe im Topspiel gegen den KSC eine unnötige 0:2-Heimpleite folgte. Punktgleich mit den drittplatzierten Lauterern verabschiedete sich unser FCSP auf Platz sechs in die Winterpause. Aus dieser kamen die Braun-Weißen nicht allzu gut raus. Dem 2:2 beim späteren Absteiger Bielefeld folgte eine 0:1-Heimpleite gegen Bochum. Wie im Hinspiel wurde Dresden dann aber mit 2:1 besiegt, 2:1 hieß es anschließend auch gegen Union Berlin. Eine ärgerliche 0:1-Pleite beim FSV Frankfurt sollte den Sprung auf Relegationsplatz drei verhindern.
Die Niederlage steckten die Vrabec-Schützlinge gut weg, in Düsseldorf siegte sie mit 2:0, gegen Ingolstadt kam sie dann aber nicht über ein torloses Remis hinaus. Acht Spieltage vor Schluss ging’s dann nach Paderborn, wo die Braun-Weißen im Topspiel verdient mit 0:3 verlieren sollten. Gegen Fürth wurde anschließend ein Remis (2:2) geholt, der SV Sandhausen dann aber mit 3:2 besiegt.
Fünf Spieltage vor Schluss betrug der Rückstand auf die drittplatzierten Paderborner sechs Zähler. Die Aufstiegshoffnung schwanden nach dem 2:3 in Kaiserslautern und als die Kiezkicker nach dem 1:1 in Cottbus zuhause gegen Aalen mit 0:3 unterlagen, war auch die letzte Chance auf den Aufstieg dahin. Beim letzten Auswärtsspiel der Saison gab es in Köln eine 0:4-Packung, zum Abschluss gegen Aue noch mal ein 2:2. Die Partie gegen die Erzgebirgler war zugleich das letzte Pflichtspiel von Fabian Boll. Wenngleich der erhoffte Sieg zum Ende seiner Profi-Laufbahn nicht gelingen sollte, wurde Boller frenetisch von den St. Pauli-Fans gefeiert.
Die Saison beendeten die Braun-Weißen hinter Köln, Paderborn (beide Aufsteiger), Fürth, Kaiserslautern, Karlsruhe, Düsseldorf und 1860 München auf dem achten Rang. Angesichts der Tatsache, dass sie nahezu die gesamte Saison lang an den Aufstiegsrängen geschnuppert hatten, konnte man mit der Platzierung nicht zufrieden sein.
So viel sei vorweg genommen: Mit Platz acht hätte jeder St. Paulianer in der Saison 2014/2015 besser leben können als mit dem, was kommen sollte. Aber der Reihe nach. Zum Saisonstart trennte sich der FC St. Pauli vom späteren Zweitliga-Meister und Aufsteiger FC Ingolstadt mit 1:1. Wie zum Ende der Vorsaison verloren die Kiezkicker dann gegen Aalen (0:2). Im DFB-Pokal siegte die Vrabec-Elf dann mit 3:1 beim FSV Optik Rathenow. In Runde zwei sollte Ende Oktober dann Borussia Dortmund ans Millerntor reisen. Die Überraschung blieb aus, mit 3:0 behielt die Klopp-Elf klar die Oberhand.
Zurück zum Liga-Geschehen: Dank eines Last-Minute-Treffers von Lasse Sobiech besiegte der FCSP Sandhausen mit 2:1, in Fürth hagelte es dann aber eine deutliche 0:3-Niederlage, auf die dann die prompte Beurlaubung von Roland Vrabec folgte. Sein Nachfolger wurde der bisherige U23-Trainer und langjährige Kiezkicker Thomas Meggle. Er konnte die beiden Niederlagen gegen 1860 München (1:2) und Aue (0:3) nicht verhindern, dann aber legten seine Schützlinge einen kurzen Lauf hin. 1:0 gegen Braunschweig, 3:3 beim FSV Frankfurt und 3:0 gegen Union Berlin. Dank des Zwischenhochs verließen die Kiezkicker die Abstiegsränge.
Knapp mit 0:1 ging dann das Gastspiel in Düsseldorf verloren, ehe am Millerntor eine bittere 0:4-Heimniederlage gegen den KSC zu Buche stand. Nach dem Pokal-Aus gegen den BVB trennte man sich von Nürnberg mit 2:2 – in letzter Sekunde erzielte den Club den Ausgleichstreffer. Ein Schlüsselerlebnis, denn vom späten Remis geschockt folgte gegen den stark gestarteten Aufsteiger aus Heidenheim ein 0:3 am Millerntor. Es folgten weitere Niederlagen in Leipzig (1:4) und gegen Kaiserslautern (1:3). Nach der Pleite gegen den FCK rutschten die Kiezkicker ans Tabellenende. Ein ärgerliches 3:3-Unentschieden gab es anschließend in Bochum. Dabei schafften es die Braun-Weißen nicht, die dreimalige Führung mit drei Punkten zu belohnen.
Nach dem 0:1 gegen den Liga-Neuling Darmstadt, der später sensationell aufsteigen sollte, beendete der FCSP die Hinrunde mit 3 Siegen, 4 Remis und 10 Niederlagen als Tabellenletzter. Erneut reagierten die Verantwortlichen und so wurde Sportchef Rachid Azzouzi beurlaubt. Der bisherige Cheftrainer Thomas Meggle wurde Azzouzis Nachfolger, Ewald Lienen der neue Cheftrainer. Unter Lienen verloren die Kiezkicker Ingolstadt knapp mit 1:2, im letzten Spiel vor der Winterpause konnte Abstiegskonkurrent Aalen dann aber mit 3:1 besiegt werden.
Mit drei Neuen (Julian Koch, Waldemar Sobota, Armando Cooper) gingen die Braun-Weißen nach dem Jahreswechsel dann das Projekt #klassehalten an. Dabei traf die Lienen-Elf zu Beginn mit Sandhausen, Fürth, 1860 München und Aue gleich auf vierdie Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Auf das torlose Remis zum Auftakt gegen Sandhausen folgte ein bitteres 0:1 gegen Fürth. Eine weitere Niederlage (1:2) folgte dann in München. Trotz Überlegenheit in allen drei Spielen sollte am Ende nur ein Punkt herausspringen. Gegen Aue folgte dann wieder nur ein torloses Remis. Nach 23 Spieltage rangierten die Kiezkicker weiterhin am Tabellenende, vier Zähler betrug der Rückstand auf den rettenden 15. Platz bereits.
Umso überraschender dann der erste Auswärtssieg der Saison bei Eintracht Braunschweig – mit 2:0 wurden die Niedersachsen verdient besiegt. Es folgten ein 1:1 gegen den FSV Frankfurt und ein 0:1 bei Union Berlin. Hier besonders bitter: In der Schlussminute sorgte der unebene Rasen in Berlin dafür, dass Keeper Robin Himmelmann den Ball nicht richtig traf und Unions Sebastian Polter den Siegtreffer erzielen konnte.
Vor der letzten Länderspielpause der Saison hieß es erneut: FCSP am Tabellenende. Im Saisonendspurt konnten die Braun-Weißen dann aber vier der letzten sieben Partien für sich entscheiden. Erst wurde Düsseldorf am Millerntor mit 4:0 besiegt. Nachdem es in Karlsruhe (0:3) nichts zu holen gab, wurde Nürnberg mit 1:0 bezwungen. Auch in Heidenheim gab es beim 1:2 keine Punkte, ehe die Lienen-Elf zum Triple ansetzte. Erst wurde Leipzig mit 1:0 besiegt, dann Kaiserslautern auf dem Betzenberg mit 2:0. Im letzten Heimspiel feierten Sören Gonther & Co. dann den höchsten Saisonsieg. Mit 5:1 konnte der VfL besiegt werden. Die Belohnung: der Sprung auf die Nichtabstiegsränge.
Der letzte Spieltag hätte kaum spannender verlaufen können: Neben unserem FCSP kämpften auch Fürth, Frankfurt, München und Aue gegen den Abstieg. In Darmstadt unterlagen die Braun-Weißen zwar mit 0:1, doch der Klassenerhalt konnte dank der Ergebnisse der Mitkonkurrenten gefeiert werden. Der FSV rettete sich dank eines 3:2-Erfolgs in Düsseldorf, 1860 unterlag dem KSC und landete auf Platz 16, Aue konnte in Heidenheim trotz Aufholjagd (nach 0:2 noch 2:2) keinen Sieg mehr holen und stieg neben Schlusslicht Aalen direkt ab.
Unsere Kiezkicker landeten am Ende mit Platz 15 gerade noch überm Strich. Dank eines Schlussspurts feierten sie nach einer enttäuschenden Saison ausgelassen den Klassenerhalt.
Eines sei gesagt: Wer die letzte Saison unseres FC St. Pauli überstanden hatte, der wurde in dieser Saison belohnt. Auf dem Transfermarkt war es zur Saison 2015/16 relativ ruhig um die Kiezkicker, denn der Kern der Mannschaft blieb aus der letzten Saison bestehen. Neu dazu stießen Jeremy Dudziak, Marc Hornschuh, Fafa Picault und Ryo Miyaichi. Bitter: Letzterer verletzte sich schon im Training und fiel fast die gesamte Saison aus. Marcel Halstenberg, Sebastian Schachten, Philipp Tschauner, Dennis Daube, Christopher Nöthe und Markus Thorandt verließen die Kiezkicker in verschiedene Richtungen. Flo Kringe beendete seine Karriere als Profi.
Auch wenn es im Saisonauftakt gegen Aufsteiger Bielefeld (0:0) noch durchwachsen aussah, drehten die Kiezkicker danach auf und gewannen drei Ligaspiele in Folge. Los ging es mit einem Auswärtssieg beim KSC (1:2), danach gewann man zuhause gegen Greuther Fürth (3:2) und bezwang dann Ligafavoriten und späteren Aufsteiger RB Leipzig in deren Heimat (0:1). Zwischenzeitlich wurde diese Erfolgsserie vom Pokal Aus in der ersten Runde gegen Borussia Mönchengladbach (1:4) gedämpft, aber so konnte sich die Lienen-Elf voll und ganz auf das Ligageschehen konzentrieren.
Am fünften Spieltag musste man sich dann zum ersten Mal in der laufenden Saison geschlagen geben. Gegen den FSV Frankfurt verlor man im Volksbank Stadion mit 0:1. Die Boys in Brown fingen sich aber schnell wieder und gewannen gegen Duisburg souverän mit 2:0. Auch in Braunschweig konnte am siebten Spieltag ein Punkt geholt werden, die beiden Teams trennten sich torlos. Nach einem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) und einem erneuten Remis in Paderborn (0:0) konnten sich die Kiezkicker vor dem zehnten Spieltag auf Platz drei der Tabelle festsetzen.
Am zehnten Spieltag folgte dann allerdings die zweite Niederlage der laufenden Saison. Am Millerntor verfolgten fast 30.000 Fans gespannt das Spiel gegen den SV Sandhausen (1:3). Auch die neue Nordtribüne war diese Saison fertig gestellt worden und bebte unter den Gesängen beider Fan Lager. Danach ging es Auswärts zu Union Berlin, mit denen man sich nach packender Aufholjagd und einem bitteren Last-Minute-Tor auf ein 3:3 einigte. Überraschend: ausgerechnet gegen den späteren Zweitligameister Freiburg holte man am Millerntor den nächsten Dreier (1:0).
Auf ein 1:1 auswärts beim VfL Bochum sollte dann ein Highlight folgen: Thy-Time am Millerntor. Lenny Thy beglückte das Millerntor am 9. November 2015 mit vier Toren gegen die Fortuna aus Düsseldorf. 4:0 war auch das Endergebnis, Nummer zwei nach diesem 14. Spieltag der Tabellenplatz. Balsam für die Seele eines jeden Pauli Fans nach der verpatzten vorigen Saison. Spätestens jetzt wusste jeder: Ewald Lienen und der FC St. Pauli: Das passt wie die Faust aufs Auge.
Leider folgte, wie so oft, auf Freude Leid und auf diesen fulminanten Auftritt eine Durststrecke. Gegen 1860 München verlor man im Süden 2:0, gegen die späteren Relegations-Kandidaten vom 1. FC Nürnberg stand sogar eine ganz bittere 0:4 Niederlage zu Buche. In die Winterpause ging die Lienen-Elf allerdings mit zwei versöhnlichen Partien. Gegen Kaiserslautern konnte auswärts ein 2:1 Sieg errungen werden, und gegen Anfangsgegner Bielefeld trennte man sich, wie zu Beginn der Hinrunde, erneut torlos. Der FC St. Pauli überwinterte auf Platz vier.
Nach der Winterpause gingen motivierte Kiezkicker ins erste Heimspiel gegen den KSC. Die Karlsruher nahmen dann aber leider drei Punkte mit an den Rhein (1:2). Doch unsere Jungs kämpften sich zurück und nahmen den ersten Dreier nach der Pause aus Fürth mit (0:2). Dann ging es wieder gegen den direkten Rivalen RB Leipzig, gegen den man erneut ein 1:0 Sieg erringen konnte. St. Pauli ist damit die einzige Mannschaft, die Leipzig in beiden Spielen der Saison bezwingen konnte.
Die Aufstiegsplätze waren in greifbarer Nähe und obwohl die Mannschaft und Trainer Lienen immer wieder die Favoritenrolle von sich wiesen, träumten viele Fans schon vom Oberhaus. Doch erneut waren es ausgerechnet die späteren Absteiger vom FSV Frankfurt, die der Erfolgsserie einen Abbruch taten. 1:3 verloren die Boys in Brown am Millerntor gegen die Hessen und blieben somit auf dem vierten Rang. Am 23. Spieltag konnte man dann in Duisburg erneut mit einem 0:2 gewinnen, und auch Braunschweig bezwang man zuhause (1:0).
Darauf folgten erneut zwei Niederlagen: Zunächst auswärts beim 1. FC Heidenheim (2:0) und am 26. Spieltag verlor man, trotz einer spektakulären Aufholjagd, gegen späteres Ligaschlusslicht Paderborn mit 3:4. Ärgerlich: Ausgerechnet gegen die beiden Direktabsteiger ließ man wertvolle Punkte liegen, die am Ende für den Aufstieg entscheidend hätten sein können. In Sandhausen holte man dann aber erneut einen Sieg ein (0:2), bevor es gegen Union Berlin zur ersten Punkteteilung nach der Winterpause kam (0:0). Darauf folgte eine erneute Niederlage bei den späteren Meistern aus Freiburg (4:3), durch die man vom VfL Bochum auf Platz fünf verdrängt wurde.
Und gegen genau diesen direkten Rivalen ging es auch, als das nächste Mal Hells Bells erklang. Am 30. Spieltag konnte man Bochum mit einem 2:0 bezwingen und holte sich Platz vier zurück. Nach einem Unentschieden bei der Fortuna Düsseldorf (1:1) und zwei Niederlagen gegen 1860 München (0:2) und beim drittplatzierten Nürnberg (1:0) waren am vorletzten Spieltag die Aufstiegsträume endgültig ausgeträumt. Beim Ligafinale galt es nun Platz vier zu sichern, was unsere Boys in Brown zuhause gegen Kaiserslautern auch mit vollem Einsatz taten. Nach einem grandiosen Tor Fest zum Abschluss der Saison (5:2), verabschiedeten sich die Kiezkicker auf einem sehr guten Platz vier in die wohl verdiente Sommerpause.
Die Kiezkicker wollten mit den Neuzugängen Vegar Eggen Hedenstad (SC Freiburg), Aziz Bouhaddouz (SV Sandhausen), Cenk Sahin (Medipol Basaksehir), Richard Neudecker (TSV 1860 München), Jakob Rasmussen (FC Schalke 04 U19), Marvin Ducksch (Borussia Dortmund) und Rückkehrer Christopher Avevor (Fortuna Düsseldorf) in der Saison 2016/17 an die zumeist guten Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen, das gelang ihnen vor allem in der Hinrunde mal so überhaupt nicht.
Wenngleich nach dem 3:0 beim Regionalligisten VfB Lübeck „ausnahmsweise“ mal wieder die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht wurde, lieferten die Boys in Brown in der Liga lange Zeit richtig schwache Auftritte ab. Nach 15 Spieltagen lagen sie mit nur 1 Sieg, 4 Remis und 10 Niederlagen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nach drei Pleiten gegen Stuttgart (1:2), Braunschweig (0:2) und Dresden (0:1) zum Auftakt bejubelten die Kiezkicker Anfang September gegen Bielefeld (2:1) den vorerst letzten dreifachen Punktgewinn.
Nach zwei Remis gegen Karlsruhe (1:1) und 1860 München (2:2) folgten vier Niederlagen in Folge – 0:2 bei Union Berlin und Hannover 96, 1:2 gegen Aue und 0:3 in Sandhausen. Nach dem Pokal-Aus gegen Hertha BSC (0:2) holten die Braun-Weißen gegen Nürnberg (1:1) zunächst einen Zähler, in Würzburg (0:1), gegen Düsseldorf (0:1) und Heidenheim (0:2) gab’s dann aber nichts zu holen. Wenngleich das anschließende 0:0 gegen Kaiserslautern eigentlich zu wenig war, konnten sich die Braun-Weißen über das erste Zu-Null-Spiel seit dem Pokalspiel in Lübeck freuen. Kurz vor Weihnachten dann der Befreiungsschlag: Die Boys in Brown gewannen mit 2:0 in Fürth, ehe zum Abschluss gegen Bochum ein 1:1 folgen sollte. Dennoch: Mit lediglich elf Zählern lieferten die Kiezkicker die schlechteste Hinrunde seit 14 Jahren ab, als Tabellenletzter betrug der Rückstand auf das rettende Ufer aber nur drei Punkte.
Der Start in die Rückrunde verlief dann sehr unglücklich, der spätere Aufsteiger Stuttgart entführte spät drei Punkte vom Millerntor (0:1). Wer dachte, dass es wie in der Hinrunde weitergehen würde, wurde erfreulicherweise getäuscht, denn die Braun-Weißen lieferten anschließend starke Leistungen ab: 2:1 in Braunschweig, 2:0 gegen Dresden, 1:1 in Bielefeld, 5:0 gegen Karlsruhe und 2:1 bei 1860 München. Die Kiezkicker kletterten hoch auf Platz 15, der Vorsprung auf relegationsplatz 16 betrug drei Punkte. Es folgten jedoch vier Spiele ohne Sieg: 1:2 gegen Union Berlin, 0:0 gegen Hannover 96, 0:1 in Aue und 0:0 gegen Sandhausen. Die Boys in Brown rutschten sieben Spieltage vor dem Saisonende auf Rang 17 ab mit drei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer.
Der Schlussspurt hatte es dann aber in sich: 2:0 in Nürnberg, 1:0 gegen Würzburg, 3:1 in Düsseldorf, 3:0 gegen Heidenheim. Nach dem anschließenden 2:1-Erfolg in Kaiserslautern feierten die Boys in Brown den zu solch einem frühen Zeitpunkt nicht für möglichen gehaltenen Klassenerhalt. Mit einem 1:1 gegen Fürth verabschiedete sich die Elf von Cheftrainer Ewald Lienen dann von ihren Fans am Millerntor, in Bochum gelang am letzten Spieltag dann aber noch mal ein 3:1-Erfolg. Dieser schraubte das Punktekonto in der Rückrunde auf ganz starke 34 Zähler. Es sollte die beste Rückrunde in Liga zwei in der Vereinsgeschichte werden und dank dieser beendete die Kiezkicker – in der Hinrunde mit elf Punkte noch Tabellenletzten – die Saison mit 45 Zählern sogar auf dem siebten Platz.
Mit dem Ziel, nicht wieder um den Klassenerhalt zu kämpfen, sondern einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, starteten unsere Kiezkicker in die neue Spielzeit. Neben Luca Zander (auf Leihbasis von Werder Bremen gekommen), Sami Allagui (Hertha BSC) und Clemens Schoppenhauer (Würzburger Kickers), aber ohne Ryo Miyaichi (er zog sich in der ersten Trainingswoche erneut einen Kreuzbandriss zu) starteten die Kiezkicker mit ihrem neuen Cheftrainer Olaf Janßen (er löste Ewald Lienen ab, der zukünftig den Posten des Technischen Direktors übernehmen sollte) mit drei Neuzugängen in die neue Spielzeit.
Nach einer optimalen Vorbereitung mit sieben Siegen in sieben Spielen (darunter ein 2:1-Erfolg gegen Bundesligist Werder Bremen) siegten die Boys in Brown beim Ligastart in Bochum mit 1:0, im ersten Heimspiel kamen die Boys in Brown dann aber nicht über eine 2:2-Remis hinaus. Die ersten drei Treffer der Saison erzielte Christopher Buchtmann. Dann aber die erste Niederlage der Saison, im DFB-Pokal schieden die Braun-Weißen bei Drittligist SC Paderborn mit 1:2 aus. Mit wechselhaften Leistungen ging es dann in der Liga weiter: 0:3 in Darmstadt, 1:0 gegen Heidenheim und Nürnberg, 0:4 gegen Ingolstadt. Auf den 1:0-Erfolg im Nordduell bei Holstein Kiel folgte ein 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf, in Braunschweig siegten die Kiezkicker Anfang Oktober dann aber wieder mit 2:0.
Es sollte bis Mitte Dezember der letzte dreifache Punktgewinn bleiben, denn bei der Janßen-Elf ging anschließend nicht viel. Nach vier Remis und der zwischenzeitlichen 0:1-Pleite bei Union Berlin hagelte es in Fürth (0:4) und Bielefeld (0:5) nach sehr schwachen Auftritten deutliche Niederlagen. Die Braun-Weißen rutschen auf Platz 14 ab, bei nur noch zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge. Der Verein reagierte: Olaf Janßen wurde nach nur 20 Punkten aus 16 Spielen beurlaubt und Markus Kauczinski als neuer Cheftrainer geholt. Das Debüt des langjährigen Coaches des Karlsruher SC endete gegen Duisburg mit einem 2:2, zum Jahresende folgte mit dem 2:1 gegen Bochum ein erfolgreicher Abschluss.
Die in der ersten Saisonhälfte wechselhaften Leistungen sollten sich auch nach dem Jahreswechsel fortsetzen: 3:1 in Dresden, 0:1 gegen Darmstadt, 0:0 gegen den späteren Aufsteiger Nürnberg. Gegen starke Ingolstädter dann aber ein 1:0-Erfolg und auch gegen die ebenfalls stark aufspielenden Kieler wurde mit 3:2 gewonnen. Der zwischenzeitliche Lauf sorgte dafür, dass der Abstand der auf Platz neun liegenden Kiezkicker auf die drittplatzierten Kieler nur noch drei Zähler betrug. Beim späteren Aufsteiger Düsseldorf setzte es aber eine 1:2-Pleite und die drei Unentschieden gegen Braunschweig (0:0), Kaiserslautern (1:1) und Sandhausen (1:1) ließen jegliche Aufstiegsträumerei davonfliegen.
Der Abstand auf Relegationsplatz drei wuchs auf acht Zähler an. Weil die Teams im unteren Drittel fleißig punkten konnten, schrumpfte der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf nur noch drei Zähler. Sechs Spieltage vor Schluss hieß es auf einmal wieder: Abstiegskampf. Und es sollte noch brenzliger werden. Nach drei Niederlagen am Stück gegen Aue (1:2), Union (0:1) und Regensburg (0:3) rutschten die Boys in Brown auf Platz 16 ab. Die 3. Liga rückte bedrohlich näher. Mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Fürth meldeten sich die Braun-Weißen dann aber eindrucksvoll zurück. Mit dem darauffolgenden 1:0-Heimsieg gegen Bielefeld machten die Kiezkicker den Klassenerhalt aber schon perfekt. Die Erleichterung nach dem Abpfiff war riesig und so tat die abschließende 0:2-Niederlage in Duisburg auch nicht mehr wirklich weh.
Mit wenigen Neuzugängen (neben mehreren Eigengewächsen blieben Defensiv-Allrounder Marvin Knoll von Jahn Regensburg und der zuvor ausgeliehene, nun aber fest verpflichtete Mats Möller Daehli die einzigen externen Neuzugänge) startete der FC St. Pauli in die neue Spielzeit. Zum Auftakt siegten die Boys in Brown beim 1. FC Magdeburg mit 2:1, neben Christopher Buchtmann traf auch Neuzugang Knoll. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Darmstadt 98 ging’s erfolgreich weiter, ehe wie in fast jedem Jahr das frühe Aus im DFB-Pokal folgte. Beim starken Drittligisten SV Wehen Wiesbaden unterlagen die Kiezkicker mit dem kurz zuvor verpflichteten Angreifer Henk Veerman (SC Heerenveen) mit 2:3 nach Verlängerung.
Auf das Pokal-Aus folgten drei Niederlagen in der Liga: 1:4 bei Union Berlin, 3:5 gegen den 1. FC Köln und 1:3 bei Erzgebirge Aue. In der Tabelle ging’s runter von Platz eins auf Rang zehn. Beim FC Ingolstadt gelang der Elf von Cheftrainer Markus Kauczinski dann aber die Wende, Joker Ryo Miyaichi erzielte den späten 1:0-Siegtreffer. Gegen den starken Aufsteiger SV Paderborn gelang in der Nachspielzeit ein Last-Minute-Sieg, Richard Neudecker der gefeierte Siegtorschütze. Mit viel Selbstvertrauen gingen die Braun-Weißen in das Hinspiel gegen die erstmals in Liga zwei abgestiegenen „Rothosen“. Das mit viel Spannung erwartete erste Zweitliga-Derby konnte die Erwartungen nicht erfüllen und endete ohne große Höhepunkte torlos.
Anschließend folgten zwei weitere späte Sieg, gegen Sandhausen (3:1) trafen Sami Allagui und Christopher in der Nachspielzeit, in Duisburg traf Allagui kurz vor dem Abpfiff. Dämpfer dann im Nordduell gegen Holstein Kiel, mit 0:1 unterlagen die Kiezkicker daheim. Es sollte die letzte Niederlage des Jahres bleiben, denn bis Weihnachten lieferten die Kauczinski-Schützlinge viele gute Leistungen ab. Nach dem 2:1-Erfolg in Bielefeld folgten zunächst drei 1:1-Remis gegen Heidenheim, Regensburg und Dresden, dank der Siege gegen Bochum (3:1), Fürth (2:0) und Magdeburg (4:1) verabschiedeten sich die Boys in Brown mit einem richtig guten Gefühl als Tabellendritter in die Winterpause.
Weil sich Henk Veerman gegen Magdeburg einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, verpflichtete der Verein für die zweite Saisonhälfte einen alten Bekannten: Alex Meier. Der bei Eintracht Frankfurt zum Fußballgott gekrönte Stürmer konnte die 1:2-Auftaktniederlage in Darmstadt nach dem Jahreswechsel nicht verhindern, sorgte mit zwei Treffern im anschließenden Topspiel gegen Union Berlin aber für einen viel umjubelten 3:2-Heimsieg. Die Braun-Weißen waren mittendrin im Aufstiegsrennen, mussten in Köln aber eine deutliche 1:4-Niederlage verkraften und rutschen von Platz drei auf fünf ab. Eine weitere Pleite folgte gegen Angstgegner Aue (1:2), ehe die Boys in Brown sowohl gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt (1:0) als auch gegen den Mitkonkurrenten SC Paderborn (1:0) drei Zähler holen konnten.
Mit einem Sieg im anschließenden Derby-Heimspiel wollte die Kauczinski-Elf bis auf einen Zähler an den zweitplatzierten Hamburger SV heranrücken, doch die Boys in Brown erwischten einen rabenschwarzen Tag und unterlagen deutlich mit 0:4. Die Niederlage war der negative Wendepunkt einer bis dahin sehr guten Spielzeit. Auch in Sandhausen stand ein bitteres 0:4 zu Buche, das Heimspiel gegen Schlusslicht Duisburg endete torlos und in Kiel unterlagen die Boys in Brown trotz Überzahl und 1:0-Führung mit 1:2. Der Verein reagierte und beurlaubte sowohl Sportchef Uwe Stöver als auch Cheftrainer Markus Kauczinski.
Dessen Nachfolge trat Jos Luhukay an, sein Debüt gegen Bielefeld endete 1:1. Nach dem anschließenden 0:3 in Heidenheim gab es endlich wieder Grund zum Jubeln: Die Kiezkicker besiegten Jahn Regensburg in einer packenden Partie mit 4:3. Auch wenn die Kiezkicker unter Luhukay erfrischenden Offensivfußball spielten, blieb die gewünschten Ergebnisse aus. In Dresden unterlagen die Braun-Weißen unglücklich mit 1:2, das letzte Heimspiel gegen Bochum endete trotz starker Leistung torlos. Beim Saisonabschluss in Fürth kassierte die Luhukay-Elf in der Nachspielzeit das 1:2 und beendete die Saison nicht auf Platz sechs, sondern nur auf Rang neun.
Mit noch nicht allen Neuzugängen, einige Akteure wechselten erst im Laufe des Augusts ans Millerntor, starteten unsere Kiezkicker nach dem enttäuschenden Ende der Vorsaison in die neue Spielzeit. Der Auftakt verlief nahezu perfekt, erst ein spätes Gegentor sorgte für nur einen Zähler beim späteren Zweitligameister Arminia Bielefeld, das erste Heimspiel gegen Fürth ging dann mit 1:3 verloren, dabei verletzte sich Kapitän Christopher Avevor so schwer, dass er erst zum Ende der Saison zurückkehren sollte. Wechselhaft ging's für die Braun-Weißen weiter. 7:6 nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal beim VfB Lübeck, Last-Minute-Niederlage beim VfB Stuttgart (1:2) und erster Heimsieg der Saison gegen Holstein Kiel (2:1).
Nach einem turbulenten 3:3 bei Dynamo Dresden (unsere Boys in Brown hatten bereits 3:0 geführt) kam es zum Derby-Hinspiel am Millerntor und die Luhukay-Elf war auf den Punkt da. Sie lieferte ihr wohl bestes Hinrundenspiel ab und besiegten die "Rothosen" dank eines Treffers von Dimitrios Diamantakos und eines Eigentores von Rick van Drongelen mit 2:0. Es war der erste Derby-Heimsieg seit 59 Jahren. Bis Mitte Oktober blieben unsere Kiezkicker nach abwechselnden Heimsiegen und Remis in der Fremde ungeschlagen und kletterten auf Rang fünf, bei allerdings nur fünf Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Die 0:1-Heimpleite gegen Darmstadt 98 war dann der Auftakt einer insgesamt acht Partien umfassende Serie, in der unsere Kiezkicker kein Spiel gewinnen konnten, darunter auch das Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (1:2). In der Liga ging's runter auf Rang 15, bei nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge.
Der Jahresabschluss mit den beiden Heimspielen gegen den späteren Absteiger Wehen Wiesbaden und Meister Arminia Bielefeld hätte dann nicht besser laufen können. 3:1 gegen den SVWW und 3:0 gegen Bielefeld. Gegen die Arminia lieferte die Luhukay-Elf ihr wohl bestes Spiel im Kalenderjahr 2019 ab und fügte dem späteren Aufsteiger die einzige Auswärtsniederlage der gesamten Saison zu. Das positive Gefühl wollten die Braun-Weißen nach dem Jahreswechsel mitnehmen, zum Auftakt kassierten sie in Fürth (0:3) allerdings einen herben Dämpfer. Neben zwei Remis am Millerntor (1:1 gegen den späteren Aufsteiger VfB Stuttgart, 0:0 gegen den späteren Absteiger Dresden) ging die Partie in Kiel (1:2) verloren.
Mit nicht ganz so breiter Brust reisten die Boys in Brown somit zum Derby-Rückspiel in den Volkspark. Aber wie schon im Hinspiel erwischten sie den deutlich besseren Tag und siegten dank der Treffer von Henk Veerman und Matt Penney verdient mit 2:0. Zwei Derbysiege in einer Saison nach Einführung der Fußball-Bundesliga - das gab's zuvor noch nie! Erfolgreich ging's am Millerntor mit dem 3:1 gegen den VfL Osnabrück weiter, beim SV Sandhausen gab's ein 2:2. Und dann folgte die Ligapause wegen der Corona-Pandemie. Diese dauerte am Ende zehn Wochen, ehe der Spielbetrieb dank des DFL-Konzepts wieder aufgenommen wurde - die verbleibenden neun Spieltage wurden ohne Fans ausgetragen.
Der Nach-Corona-Auftakt gelang unseren Jungs, am Millerntor besiegten sie den 1. FC Nürnberg mit 1:0. Während die Luhukay-Elf daheim viele Punkte holen konnte, lief es in der Fremde selten wie gewünscht und so blieben die Braun-Weißen in allen fünf Nach-Corona-Auswärtsspielen sieglos und kassierten dabei teils heftige Niederlage wie in Darmstadt und Hannover (jeweils 0:4). Am Millerntor lief's deutlich besser: Auf das 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim, der am Ende die "Rothosen" abfangen und von Relegationsplatz drei verdrängen konnte, folgte ein 2:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue. Im letzten Heimspiel der Saison 2019/20 mussten sich unsere Kiezkicker mit einem 1:1 gegen den SSV Jahn Regensburg zufrieden geben, dank des Unentschiedens sicherten sie am vorletzten Spieltag aber die Klasse. Zum Abschluss wollten sie auswärts noch mal drei Zähler holen, es sprang aber eine turbulente 3:5-Pleite bei Wehen Wiesbaden und ein unzufriedenstellender Platz 14 in der Endabrechung heraus.
Großer Umbruch zur Saison 2020/21! In die zehnte Zweitliga-Saison in Folge starteten die Kiezkicker mit vielen personellen Veränderungen. Neu dabei waren u.a. der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Rodrigo Zalazar, die ehemaligen Wiesbadener Daniel Kofi-Kyereh und Maximilian Dittgen oder auch Guido Burgstaller, der kurz nach dem Saisonstart von Schalke 04 verpflichtet wurde. Ganz neu das Trainerteam: Timo Schultz, langjähriger Kiezkicker und zuvor U19-Cheftrainer, übernahm das Amt von Jos Luhukay und holte sich mit Loïc Favé und Fabian Hürzerer zwei junge Co-Trainer dazu.
Mit einem gefühlten Sieg starteten die Braun-Weißen in die Saison, nachdem sie beim späteren Zweitliga-Meister VfL Bochum bis kurz vor Schluss noch mit 0:2 zurückgelegen hatten, dank zweier Treffer von Daniel-Kofi Kyereh aber doch noch einen Zähler holten. Richtig stark präsentierten sich die Kiezkicker dann gegen den 1. FC Heidenheim – mit 4:2 gewannen sie das erste Heimspiel der Saison. Was zu diesem Zeitpunkt niemand erwartet hatte: Es sollte der vorerst letzte Sieg bis Mitte Januar sein. Aber der Reihe nach.
Nach einer unnötigen 0:1-Niederlage beim SV Sandhausen folgte nach zwei 2:2 gegen Nürnberg und Darmstadt, hier zeigten die Kiezkicker in beiden Spielen nach Rückstand eine gute Moral. Dann kam es zum Derby-Hinspiel, wo unsere Kiezkicker nach frühem Rückstand durch Rodrigo Zalazar ausgleichen und durch Simon Makienok in der Schlussphase sogar in Führung gehen konnten. Die „Rothosen“ glichen aber doch noch aus und so verpassten unsere Boys in Brown den dritten Derbysieg in Folge.
Es lag nicht am verpassten Derbysieg, aber nach dem Duell mit dem Stadtrivalen lief es für die Elf von Timo Schultz überhaupt nicht mehr wie gewünscht. Aus den sechs Partien bis Weihnachten holten die Braun-Weißen nur noch einen Zähler und verabschiedeten sich mit acht Punkten aus zwölf Spielen als Vorletzter in die sehr kurze Winterpause. Mit einer knappen, aber verdienten 1:2-Niederlage ging’s kurz nach dem Jahreswechsel leider weiter, im Corona-bedingt verlegten Nachholspiel bei Schlusslicht Würzburg sollte dann endlich der zweite Saisonsieg her, nach frühem Rückstand und einer Halbzeit in Unterzahl sprang dank starker Moral aber immerhin ein Punkt heraus.
Mit dem wiedergenesenen Guido Burgstaller – der Angreifer hatte sich gegen Nürnberg ein Bauchverletzung zugezogen und fiel bis Weihnachten aus – sowie den Winter-Neuzugängen Dejan Stojanović, Eric Smith und Omar Marmoush ging’s dann weiter, beim 1:1 gegen die starken Kieler sprang am Ende ein verdienter Punkt heraus. Mitte Januar bejubelten die Boys in Brown dann endlich den zweiten Saisonsieg, dank eines Last-Minute-Treffers von Igor Matanović siegten sie mit 3:2 bei Hannover 96. Es war der Startschuss einer Serie von sieben Siegen, die lediglich von der knappen 2:3-Niederlage gegen Bochum unterbrochen wurde. So siegten unsere Kiezkicker nicht nur mit 4:3 in Heidenheim, sondern u.a. auch mit 3:2 gegen Darmstadt und 1:0 im Derby-Rückspiel. Im Duell gegen den Stadtrivalen sah es lange am Millerntor nach einer Punkteteilung aus, ehe Daniel-Kofi Kyereh kurz vor dem Abpfiff sehenswert den Siegtreffer für die Boys in Brown erzielte. Es war der dritte Derbysieg aus den vergangen vier Partien gegen die "Rothosen"!
Nach einem 0:0 in Karlsruhe und einer 0:2-Heimpleite gegen Paderborn folgten gegen Osnabrück (3:1), Braunschweig (2:0), Aue (3:1) und Würzburg (4:0) vier souveräne Siege in Folge. Die Kiezkicker waren auf dem besten Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt, mussten anschließend aber eine 0:2-Niederlage in Düsseldorf verkraften. Gegen den späteren Aufsteiger Fürth war es dann aber soweit: Ende April und damit bereits drei Spieltage vor dem Saisonende bedeutete der 2:1-Heimsieg gegen die SpVgg den vorzeitigen Klassenverbleib. Die Kiezkicker, Anfang Januar noch Vorletzter, rückten auf den sechsten Rang vor, beendeten die Saison aufgrund dreier Niederlagen aber 'nur' auf Rang zehn.
Mit dem guten Gefühl der sehr starken Rückrunde in der Vorsaison starteten unsere Kiezkicker in die neue Spielzeit. Mit Svend Brodersen, Daniel Buballa und Ryo Miyaichi verließen einige langjährige Boys in Brown neben den Leihspielern Omar Marmoush, Rodrigo Zalazar und Dejan Stojanović das Millerntor. Im Gegenzug wechselten Innenverteidiger Jakov Medić (SV Wehen Wiesbaden), Linksverteidiger Lars Ritzka (SC Verl), Mittelfeldspieler Jackson Irvine (Hibernian FC) oder auch Offensiv-Allrounder Etienne Amenyido (VfL Osnabrück) zum FCSP. Nach dem zweiten Spieltag kam zudem noch Marcel Hartel (Arminia Bielefeld) hinzu.
Mit dem Saisonauftakt gegen Holstein knüpften die Kiezkicker an die starken Leistungen aus der Rückrunde der Vorsaison an, mit einem 3:0-Heimsieg legten sie vor knapp 9.000 Fans furios los. Nach dem torlosen Remis in Aue und dem 3:2-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Magdeburg bejubelten die Boys in Brown am Millerntor dann einen 3:2-Derbysieg - Finn Ole Becker und Simon Makienok (2) die Torschützen. Auch gegen den bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter Jahn Regensburg feierte die Schultz-Elf einen 2:0-Heimsieg, zuvor und danach gab es in Paderborn (1:3) und Hannover (0:1) aber keine Punkte.
Anschließend gewannen die Kiezkicker fünf Ligaspiele in Serie (u.a. 3:0 gegen Dresden und 4:0 gegen Rostock), im DFB-Pokal setzten sie sich mit 3:2 nach Verlängerung in Dresden durch und erreichten erstmals seit 16 Jahren wieder das Achtelfinale. In der Liga endete die Siegesserie mit einem Remis bei Absteiger Werder Bremen (1:1), ehe es in Darmstadt ein bittere 0:4-Pleite zu verkraften gab. Von der erholten sich die Boys in Brown schnell, Siege gegen Sandhausen (3:1), Nürnberg (3:2) und Absteiger Schalke 04 (2:1) folgten und die überragende Hinrunde mit einem Remis in Düsseldorf (1:1) mit 36 Zähler auf Platz ein beendet wurde. Kurz vor Weihnachten dann aber noch ein Dämpfer beim 0:3 in Kiel.
Mit einer Achterbahnfahrt der Gefühle starteten die Kiezkicker ins Jahr 2022. Nach dem Last-Minute-Punkt gegen Aue besiegten sie im Achtelfinale des DFB-Pokals nach großartiger Leistung Titelverteidiger Borussia Dortmund, ehe sie das Derby-Rückspiel im Volkspark nach Führung noch mit 1:2 verlieren sollten. So wechselhaft die erste Woche des Jahres war, so wechselhaft waren auch die Ergebnisse in der restlichen Rückrunde. Es war alles dabei: Siege wie die in Regensburg (3:2) und Ingolstadt (3:1), Unentschieden wie das gegen Paderborn (2:2) und Dresden (1:1) sowie Niederlagen wie die erste Heimpleite der Saison gegen Hannover (0:3) oder auch das 1:2 im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bundesligist Union Berlin.
Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Heidenheim ging's für unsere Mannschaft als Tabellenführer in den sieben Spiele umfassenden Endspurt mit gleich vier Duellen gegen direkte Konkurrenten um den Aufstieg. Nach der bitteren 0:1-Pleite in Rostock trennten sich die Braun-Weißen mit 1:1 von Bremen und auch Sandhausen. Beim SVS ließen sie in der Nachspielzeit zwei wichtige Punkte liegen, ehe sie das wichtige Duell gegen Darmstadt 98 daheim mit 1:2 verloren. Drei Spieltage vor dem Saisonende rutschte die Schultz-Elf auf Platz vier ab. Nach dem bitteren 1:1 gegen die Nürnberger, die am Millerntor in der Nachspielzeit getroffen hatten, unterlagen die Boys in Brown trotz 2:0-Führung auf Schalke noch mit 2:3 und konnte am letzten Spieltag nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen.
Nach zuvor sechs sieglosen Spielen in Folge verabschieten sie sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen Düsseldorf auf Platz fünf aus der Saison und von ihren Fans. Es wurde noch mal ein emotionales letztes Heimspiel, wurden neben Sebastian Ohlsson, James Lawrence und Rico Benatelli mit Christopher Buchtmann (seit 2012 im Verein), Philipp Ziereis (seit 2013), Finn Ole Becker (seit 2011) und Torwarttrainer Mathias Hain (seit 2008) doch vier langjährige Kiezkicker verabschiedet.
Nachdem unsere Kiezkicker im Vorjahr den Aufstieg verpasst hatten, wollten sie wieder um diesen mitspielen, doch es sollte anders kommen. Nach ordentlichem Saisonstart mit sieben Zählern aus vier Spielen sowie dem Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals blieben die Braun-Weißen weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Gerade einmal zehn weiter Zähler holte die Elf von Trainer Timo Schultz bis zum Ende der Hinrunde, der einzige weitere Sieg gelang immerhin im Heimspiel gegen den Hamburger SV. Die Boys in Brown entschieden das Derby deutlich mit 3:0 für sich.
In der aufgrund der WM in Katar bereits Mitte November beginnenden Winterpause nahmen sich die Vereinsvantwortlichen viel Zeit, um die abgelaufene Hinrunde zu analysieren. Kurz vor dem Trainingsstart Anfang Dezember entschied man sich dann, Timo Schultz zu beurlauben. Mit Fabian Hürzeler überhahm einer der beiden Co-Trainer interimsweise. Keine drei Wochen später, kurz nach Weihnachten, vermeldete der Verein dann, dass der erst 30-jährige Hürzeler den Posten des Cheftrainers übernehmen wird. Mit ihm sollte der drohende Abstieg - unser Team lag nur aufgrund der besseren Tordifferenz zum Ende der Hinrunde vor den punktgleichen Bielefeldern und Magdeburger sowie einen Zähler vor Schlusslicht Sandhausen auf Platz 15 - abgewendet.
Was soll man sagen?! Von Abstiegssorgen war wenige Wochen nach dem 1:0-Auswärtssieg in Nürnberg zum Start in die Rückrunde schon keine Rede mehr, denn unsere Mannschaft ließ einen Sieg nach dem anderen folgen. Es wurde eine historische Siegesserie, gewannen die Kiezkicker doch zehn Spiele in Folge! Das gelang bislang noch keinem Verein in der 2. Bundesliga, die Kiezkicker verbesserten die bisherige Bestmarke des Karlsruher SC, der in der Saison 1986/87 neun Spiele in Folge gewonnen hatte.
Vor allem die im Vergleich zur Hinrunde deutlich stabilere Defensive war der Garant für den Erfolg - und in der Offensive war die Hürzeler-Elf immer für mindestens einen Treffer gut. Dank der unfassbaren Siegsserie war unser Team von Platz 16 auf vier hochgestürmt, der Rückstand auf die drittplatzierten Heidenheimer betrug nur noch vier Zähler, der Abstand auf den zweitplatzierten Stadtrivalen auch nur noch deren sechs Zähler. Etwas unerwartet folgte Anfang April 2023 dann aber die erste Niederlage unter Hürzeler, daheim unterlagen die Kiezkicker Abstiegskandidat Braunschweig mit 1:2. Weil zeitgleich auch der HSV verloren hatte, konnten unsere Boys in Brown mit einem Sieg im Derby-Rückspiel auf drei Punkte an den Stadtrivalen heranrücken. Es gelang nicht, das Spiel im Volkspark ging mit 3:4 verloren.
Im Saisonendspurt blieben unsere Jungs zwar ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis), für einen der ersten drei Plätze reichte es aber nicht mehr. Am Ende stand hinter den beiden Aufsteigern aus Darmstadt und Heidenheim, dem Relegationsteilnehmer HSV und Fortuna Düsseldorf der fünfte Platz heraus. Auch wenn die absolute Sensation am Ende nicht gelingen sollte, legten die Kiezkicker mit 41 Punkten die beste Rückrunde in der Zweitliga-Historie und verabschiedeten sich mit einem mehr als guten Gefühl in die Sommerpause. Und mit dem Ziel, die starken Leistungen in der Saison 2023/24 zu bestätigen.
An die starken Ergebnisse der grandiosen Rückrunde konnten unsere Boys in Brown zum Start in die neue Saison nicht anknüpfen. Zwar bejubelten sie auf dem Lauterer Betzenberg einen 2:1-Auftaktsieg, es folgten jedoch vier Remis, darunter drei torlose, in Folge. Lediglich im DFB-Pokal wurde beim 5:0 gegen Fünftligist Altas Delmenhorst gejubelt. Mit dem 5:1-Heimsieg gegen Holstein Kiel platzte der Knoten bei unserem Team, fünf weitere Siege und ein zwischenzeitliches Remis in Paderborn sowie der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals folgten.
Zum Ende der Hinrunde gewannen unsere Kiezkicker in Rostock (3:2), ehe daheim eine 2:0-Führung gegen den HSV (2:2) nicht zum Derbysieg reichen sollte. Im Pokal ging's dank des 4:1-Erfolgs bei Regionalligist Homburg ab ins Viertelfinale. Weil unsere Mannschaft zum Abschluss der Hinrunde gegen Osnabrück und Wehen Wiesbaden (jeweils) 1:1 Punkte liegengelassen hatte, sicherte sich Kiel die Herbstmeisterschaft. Unsere Mannschaft blieb als erst sechstes Team in der Zweitliga-Historie eine komplette Halbserie lang ungeschlagen.
Nach dem Jahreswechsel legten unsere Boys in Brown in der Liga einen ganz starken Start hin. Sowohl gegen Kaiserslautern (2:0) als auch gegen die Verfolger Düsseldorf (2:1) und Greuther Fürth (3:2) setzten sie sich durch und übernahmen die Tabellenspitze. Im Pokal hingegen war nur drei Tage nach dem Sieg in Düsseldorf gegen die Fortuna dann Schluss, diese setzte sich am Millerntor nach Elfmeterschießen durch.
Im Februar verloren unsere Boys in Brown dann erstmals wieder ein Ligaspiel, in Magdeburg unterlagen sie mit 0:1. Damit endete die überragende Serie von 25 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage. Es folgten zwei Siege gegen Kellerkind Braunschweig und Verfolger Kiel, ehe unsere Jungs auf Schalke die zweite Saison-Niederlage kassierten. Wieder zeigte unser Team eine starke Reaktion, in Nürnberg, gegen Hertha BSC und Paderborn folgten drei Siege in Serie. Der sechste Aufstieg der Vereinsgeschichte rückte immer näher, betrug der Vorsprung auf die drittplatzierten Düsseldorfer doch elf und auf die viertplatzierten „Rothosen“ zwölf Zähler.
Der schmolz nach den Niederlagen in Karlsruhe (1:2) und daheim gegen Elversberg (3:4) auf nur noch fünf, bzw. acht Punkte dahin. Wieder zeigte unsere Mannschaft eine starke Reaktion. Erst setzte sie sich in Hannover (2:1) durch, ehe Hansa Rostock (1:0) im vorletzten Heimspiel der Saison besiegt wurde. Am drittletzten Spieltag zum Showdown beim HSV, der mit einem Sieg die geringe Chance auf Platz drei wahren wollte, während unsere Kiezkicker mit einem Sieg ausgerechnet im Volkspark aufsteigen konnten. Das passierte nicht, spät unterlag unser Team mit 0:1.
Am 12. Mai 2024 war es dann aber soweit. Durch den 3:1-Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden VfL Osnabrück machten die Braun-Weißen die Bundesliga-Rückkehr nach 13 Jahren Zweitklassigkeit perfekt und feierten den Aufstieg mit den FCSP-Fans. Dank des abschließenden 2:1-Erfolgs beim SV Wehen Wiesbaden sicherte sich die Hürzeler-Elf vor den zweitplatzierten Kielern dann die Meisterschaft, die am Tag danach ausgelassen mit 50.000 FCSP-Fans auf der Reeperbahn gefeiert wurde.
Fotos: Witters / inside-picture.de
Kennst Du schon das FC St. Pauli Museum?
das FC St. Pauli Museum?

Millerntor: Ein Stadion schreibt Geschichte
Heimspiele des FC St. Pauli auf dem Heiligengeistfeld haben Tradition.
Bereits mit Ende des Ersten Weltkriegs fanden dort in regelmäßigen Abständen Fußballspiele statt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Stadion völlig zerstört, aber bereits 1946 hatte der FC St. Pauli eine neue Spielstätte, die natürlich noch weit hinter den heutigen Vorstellungen eines modernen Stadions zurückblieb.
Im Jahre 1961 begannen die Bauarbeiten für das Millerntor-Stadion an seiner heutigen Stelle. Die alte Arena, die sich an der Ecke Glacischaussee/Budapester Straße befunden hatte, mußte der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) weichen.
Eingeweiht wurde das neue Millerntor-Stadion erst 1963: Die überlange Bauzeit mußte in Kauf genommen werden, nachdem vergessen worden war, eine Drainage unter dem Rasen einbauen zu lassen. Die Folge: Nach jedem heftigen Regenguß stand das Millerntor unter Wasser, Fußballspiele nach dem Regelwerk des Deutschen Fußball-Bundes waren nicht mehr möglich.
Auch nach der Einweihung vor 35 Jahren wurde das Stadion noch mehrmals baulich verändert. Vor allem die Zuschauerkapazität mußte aus Sicherheitsgründen zweimal gesenkt werden. Im Jahre 1961 zunächst für 32.000 Zuschauer gedacht, faßt das heutige Stadion noch 20.629 Zuschauer. Der Stimmung tat die Reduzierung des Fankontingents keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Kompaktheit wurde zur Stärke und trägt noch immer zur einzigartigen Faszination am Millerntor bei.
Millerntor-Stadion hieß die Kultstätte, bevor sie 1970 in Wilhelm-Koch-Stadion umbenannt wurde. Die Umbenennung wurde zu Ehren des ehemaligen Präsidenten vorgenommen, der von 1933 bis 1945 und von 1947 bis zu seinem Tod 1969 den Club führte.
Heute ist die Namensgebung umstritten, da Koch Mitglied der NSDAP war. Auf der Jahreshauptversammlung 1997 wurde deshalb ein Mitglieder-Antrag auf Umbenennung des Stadions gestellt, der in eine kontroverse Diskussion führte: Darf die Spielstätte eines liberalen und weltoffenen Clubs, wie es der FC St. Pauli ist, nach einem ehemaligen NSDAP-Mitglied benannt sein?
Die Rolle Wilhelm Kochs im Dritten Reich hat der renommierte Historiker Frank Bajohr ("Arisierung in Hamburg") inzwischen in einem Gutachten untersucht, das auf der Geschäftsstelle erhältlich ist. Bajohrs Einschätzung: "Wilhelm Koch war kein ideologisch überzeugter und parteipolitisch aktiver Nazi."
Auf der Jahreshauptversammlung am 30. Oktober 1998 wurde dennoch nach heftigen Wortgefechten für eine Umbenennung der Spielstätte entschieden. Weit nach Mitternacht lautete das sehr knappe Votum: Seit der Saison 1999/2000 heisst die Spielstätte des FC St. Pauli Millerntor-Stadion.

Am 13. Juli 2006 verkündeten der Hamburger Bürgermeister Ole von Beust und unser Vereinspräsident Corny Littmann den Plan des Neubaus. Das altehrwürdige Millerntorstadion wird einer neuen Spielstätte weichen. Hierzu sollen die alten Tribünen in vier Bauabschnitten durch neue ersetzt werden und so zukünftig 27.000 Zuschauern Platz bieten. Verläuft alles nach Plan sind diese vier einzelnen Abschnitte im Jahr 2014 fertig gestellt.
Im Dezember 2006 wurde der Plan in die Tat umgesetzt und das Projekt Stadionneubau begann. Vor den Augen von 2000 Fans begleiteten die Klänge der Hells Bells den Abriss der Südtribüne.
Mit ein wenig Verzögerung läuteten die Hellmilch- Bautrupps im Mai 2007 die Bauphase der neuen Südtribüne ein, die schon sechs Monate später im Spiel gegen Augsburg teilweise geöffnet wurde. Zu dem Spiel nutzten erstmals 1500 Fans die Stehplätze der Tribüne, bevor Anfang 2008 die gesamte Tribüne gegen Carls Zeiss Jena für Zuschauer eröffnet wurde.

Am 18. Juli 2008 fand schließlich die offizielle Einweihung der neuen Südtribüne statt. Das dazu veranstaltete Freundschaftsspiel gegen die Cubanische Nationalmannschaft gewannen unsere „Kiezkicker“ mit 7:0. Seit März 2008 befinden sich auch die Geschäftsstelle, das Ticketcenter und der Fan-Shop in der neu gestalteten Tribüne.
Im November 2009 begannen die Arbeiter dann offiziell, auch die Haupttribüne dem Erdboden gleich zu machen, um so Platz für die neue Tribüne und die Kita in der Kurve zwischen der neuen Süd- und Haupttribüne zu schaffen.
Gut zwei Monate später war das Fundament gegossen und Ende August 2010 konnte die Tribüne beim ersten Heimspiel der Saison gegen 1899 Hoffenheim eröffnet werden. Vollständig beendet war der zweite Bauabschnitt jedoch erst, als im November 2010 das Piraten-Nest als weltweit erste Kindertagesstätte in einem Fußballstadion, mit rund 100 Kita-Plätzen, seinen Betrieb aufnahm.
Nur einen Tag nach dem letzten Heimspiel der Saison 2011/12 rollten die Bagger an, um auch die alte Gegengerade in ihre Einzelteile zu zerlegen. Schon nach der Sommerpause weihten 4000 Fans die neue Gegengerade gegen Ingolstadt auf den bis dahin fertig gestellten Stehplätzen ein. Der endgültige Abschluss der Arbeiten an der neuen Gegengerade konnte nach der Winterpause gegen Cottbus gefeiert werden. Auf den rund 3000 schwarz-weißen Sitzschalen prangt seitdem nun der Schriftzug „FC St. Pauli 1910 Millerntor“, und es findet sich Platz für 10.000 weitere Fans, die ihr Team stehend anfeuern.
Im letzten Schritt wurde die Nordtribüne im Juli 2015 fertiggestellt, seitdem fasst das Millerntor-Stadion 29.546 Plätze.

Die größten Erfolge (Nicht wirklich ;-))
Wollt Ihr wirklich eine Auflistung von unzähligen Oberliga-Vizemeisterschaften, die Ergebnisse von verlorenen Viertelfinalspielen im DFB-Pokal oder die Feststellung, dass wir sechs Mal in die 1. Bundesliga (insgesamt acht Erstliga-Jahre) aufgestiegen und fünf Mal abgestiegen sind?
Begnügen wir uns doch einfach damit, daß für viele Fans des Vereins der Weg das Ziel ist. Und leidensfähig ist der St. Paulianer!
Ergänzungen für das neue Jahrtausend und vielleicht der Start einer unendlichen Ruhmestafel:
- 6. Februar 2002: "Weltpokalsiegerbesieger" durch einen 2:1-Sieg über den FC Bayern München.
- 19. Mai 2004: Gewinn des Hamburger Oddset-Pokals (2:0 über Bergedorf 85) und somit die Qualifikation für den DFB-Pokal.
- 25. Mai 2005: Gewinn und Verteidigung des Hamburger Oddset-Pokals (2:1 über Halstenbek/Rellingen) und somit die Qualifikation für den DFB-Pokal.
- 14. Juli 2005: St. Pauli ist Weltmeister! Auf der traditionellen antirassistischen Weltmeisterschaft, der "Mondiali Antirazzisti", bekommt der St. Pauli-Fanladen und die Fangruppierung Ultrà Sankt Pauli den "Coppa Mondiali Antirazzisti" überreicht.
- 25. Januar 2006: Mit dem Sieg im DFB-Pokal Viertelfinale gegen den SV Werder Bremen erreicht der FC St. Pauli zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das DFB-Pokal Halbfinale. Die Kiezkicker bekamen den FC Bayern München zugelost und unterlagen dem Rekordmeister am 12. April 2006 mit 0:3.
- 25. Mai 2007: Im letzten Heimspiel der Saison 2006/07 reicht unserem FCSP ein 2:2-Unentschieden gegen Dynamo Dresden, um am Millerntor die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu feiern.
- 2. Mai 2010: Im letzten Auswärtsspiel der Saison 2010/11 gewinnen die Kiezkicker mit 4:1 in Fürth und bejubeln den fünften Aufstieg in die 1. Bundesliga.
- 16. Februar 2011: Nachdem das Hinspiel gegen die "Rothosen" am Millerntor 1:1 geendet hatte, konnten unsere Kiezkicker das Rückspiel im Volkspark dank des Treffers von Gerald Asamoah mit 1:0 für sich entscheiden.
- 12. Mai 2024: Im letzten Heimspiel der Saison 2023/24 besiegen die Boys in Brown den VfL Osnabrück mit 3:1 und machen den sechsten Aufstieg in die Bundesliga perfekt.
Fortsetzung folgt...
Alle Präsidenten
Über viele Jahrzehnte wurde der Präsident des FC St. Pauli direkt von den Mitgliedern auf den Jahreshauptversammlungen gewählt. Seit dem 7. Februar 1997 schlägt der Aufsichtsrat den Präsidenten der Mitgliederversammlung zur Wahl vor. Die Amtszeit beträgt vier Jahre, eine Wiederwahl ist möglich.
Zeitraum und Name
- 1924 bis 1931: Henry Rehder
- 1931 bis 1945: Wilhelm Koch
- 1945 bis 1947: Hans Friedrichsen
- 1947 bis 1969: Wilhelm Koch
- 1970 bis 1979: Ernst Schacht
- 1979 bis 1982: Wolfgang Kreikenbohm
- 1982 bis 1990: Otto Paulick
- 1990 bis 2000: Heinz Weisener
- 2000 bis 2002: Reenald Koch
- 2003 bis 2010: Corny Littmann
- 2010 bis 2014: Stefan Orth
- seit 2014: Oke Göttlich
Alle Trainer seit 1945
Zeitraum und Name
- 1945 bis 1948: Hans Sauerwein
- 1948 bis 1949: Waldemar Gerschler
- 1949 bis 1951: Fred Harthaus
- 1951 bis 1952: Walter Risse
- 1952: Henner Appel
- 1952 bis 1963: Heinz Hempel
- 1963 bis 1964: Otto Westphal
- 1964 bis 1965: Otto Corps
- 1965 bis 1967: Kurt Krause
- 1967 bis 1968: Heinz Hempel
- 1968 bis 1971: Erwin Türk
- 1971 bis 1972: Edu Preuß
- 1972 bis 1974: Karl-H. Mühlhausen
- 1974 bis 1976: Kurt Krause
- 1976 bis 1978: Diethelm Ferner
- 1978 bis 1979: Sepp Piontek
- 1979: Werner Pokropp
- 1979 bis 1982: Kuno Böge
- 1982 bis 1986: Michael Lorkowski
- 1986 bis 1987: Willi Reimann
- 1987 bis 1991: Helmut Schulte
- 1991 bis 1992: Horst Wohlers
- 1992: Josef Eichkorn
- 1992: Michael Lorkowski
- 1992 bis 1994: Josef Eichkorn
- 1994 bis 1997: Ulrich Maslo
- 1997: Klaus-Peter Nemet
- 1997: Eckhard Krautzun
- 1997 bis 1998: Gerhard Kleppinger
- 1999: Dietmar Demuth
- 1999 bis 2000: Willi Reimann
- 2000 bis 2002: Dietmar Demuth
- 2002: Joachim Philipkowski
- 2002 bis 2004: Franz Gerber
- 2004 bis 2006: Andreas Bergmann
- 2006 bis 2007: Holger Stanislawski
- 2007 bis 2008: André Trulsen
- 2008 bis 2011: Holger Stanislawski
- 2011 bis 2012: André Schubert
- 2012 bis 2013: Michael Frontzeck
- 2013 bis 2014: Roland Vrabec
- 2014: Thomas Meggle
- 2014 bis 2017: Ewald Lienen
- 2017: Olaf Janßen
- 2017 bis 2019: Markus Kauczinski
- 2019 bis 2020: Jos Luhukay
- 2020 bis 2022: Timo Schultz
- 2022 bis 2024: Fabian Hürzeler
- seit Juli 2024: Alexander Blessin

Der Totenkopf: Vom Rebellsymbol zur geschützten Marke
Die Geschichte des Totenkopfs als landauf, landab bekanntes Symbol der Fans des FC St. Pauli, wenn nicht gar des Gesamtvereins, ist (vollkommen wertfrei betrachtet) eine Geschichte der Vereinnahmung und Kommerzialisierung, wie wir sie sonst nur aus dem Mode- und Musikbereich kennen.
Angefangen hat sie Mitte der 80er Jahre, als sich am Millerntor die Fan-Szene etablierte, die den Verein zukünftig prägen und bekanntmachen sollte. Hinter den Trainerbänken auf der Gegengeraden traf sich seinerzeit der "Schwarze Block", in dem sich ausschließlich Bewohner der seinerzeit heiß umkämpften Häuser an der Hafenstrasse aufgehalten haben sollen. Dies traf allerdings nur zu einem kleinen Teil zu, vielmehr handelte es sich bei dieser Gruppe um eine Menge Leute, die im angrenzenden Stadtteil St. Pauli wohnten und grob gesagt der breitgefächerten alternativen Szene angehörten. Somit bildeten sie am Millerntor nicht mehr und nicht weniger als den "Spiegel der Gesellschaft", der sich unzähligen soziologischen Erhebungen zufolge in bundesdeutschen Fußballarenen zu versammeln pflegt.
Nun, einer aus dieser Gruppe, "Doc Mabuse" genannt, wohnte jedoch tatsächlich im "6er-Block" in der Hafenstraße und war derjenige, der als erster eine Totenkopffahne mit ins Stadion schleppte. Diese Fahne war seinerzeit das hanseatische Pendant zum allseits bekannten Hausbesetzerzeichen und wurde in der Tradition jahrhundertealter Piraterie (in Hamburg seit jeher mit dem Namen Klaus Störtebeker verbunden) verwandt, soll heißen: "Arm gegen reich", "Arbeiter gegen Pfeffersäcke" etc.
Der FC St. Pauli wiederum rollte damals das (Bundesliga-)Feld von hinten auf, spielte sich innerhalb kürzester Zeit von der dritten in die erste Liga und behauptete sich sogar dort trotz minimaler finanzieller Rückendeckung mit achtbarem Erfolg, was ausschließlich der mannschaftlichen Geschlossenheit und der unerschütterlichen Unterstützung durch den "12. Mann", eben die Fans vom Millerntor, zugeschrieben wurde. So nahm diese Fanszene die Rolle des unerschrocken gegen die übermächtigen, reichen Clubs ankämpfenden Underdogs gerne an und mit ihr das passende visuelle Erkennungszeichen: die Totenkopffahne.
Diese Entwicklung wurde von den damaligen Vereinsbossen und den eher älteren Zuschauern gar nicht gern gesehen, assoziierten sie mit dem Totenkopfsymbol doch grundsätzlich etwas Gewalttätiges. Auch der offizielle Fanshop konnte und wollte auf die steigende Nachfrage nach entsprechenden Accessoires nicht reagieren, und begnügte sich mit altbackenen Aufklebern, Wimpeln etc. So nahmen die Fans wie so oft die Dinge in die eigenen Hände: Der in der Saison 1989/1990 gegründete Fan-Laden brachte T-Shirts, Sweater und einiges mehr auf den Markt, die alsbald zum Renner im Fanartikelgeschäft wurden und obendrein ein wichtiges Element zur (Selbst-)Finanzierung der Fanbetreuung darstellten. Das Totenkopf-Logo, so wie es heute verwendet wird, wurde von Steph Braun von der Firma Texmen entwickelt, der auch die Rechte an dem Logo hielt.
Am FC St. Pauli ging der Bundesliga-Boom nicht spurlos vorüber und die Anfang der 90er Jahre gegründet FC St. Pauli Marketing GmbH schickte sich an, das neudeutsch "Merchandising" genannte Fanartikelgeschäft auf moderne Grundlagen zu stellen, was im Alltag bedeutet, der Fan-Nachfrage genüge zu tun. Zunächst einigte man sich mit dem Fan-Laden darauf, daß das Sortiment mit dem Totenkopfsymbol ausschließlich dort veräußert wird und man sich selbst auf ein herkömmliches Sortiment beschränkt. Doch in der jüngeren Vergangenheit änderte sich wohl die Meinung und die Marketing kaufte dem bisherigen Inhaber, der Texmen Textildruck GmbH auf dem Kiez, die Markenrechte an dem Totenkopfsymbol ab. Mit Gründung der FC St. Pauli Vermarktungs GmbH Co. KG im Oktober 2000 und der damit verbundenen Rechteübertragung, ist der Verein nun Inhaber der Rechte.
Auch in die offizielle "Corporate Identity" des Vereins hat das Symbol mittlerweile Einzug gehalten: Die 1998 gestartete Werbekampagne "Der Starclub" benutzte es gleichwertig neben dem Vereinswappen.
Bisheriger Höhepunkt: Auf den Trikots der Saison 2000/2001 prangt, mittig im Kragen angebracht, das Totenkopfsymbol. Dies ist der derzeitige Stand einer Geschichte, die vor über 600 Jahren irgendwo auf den Weltmeeren anfing, vor 15 Jahren mit Dosenbier trinkenden Hausbesetzern in einem deutschen Fußballstadion weitergeführt wurde und vielleicht irgendwann an der Börse endet?
Kontakt Traditionsmannschaft